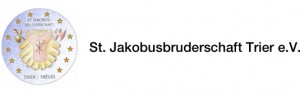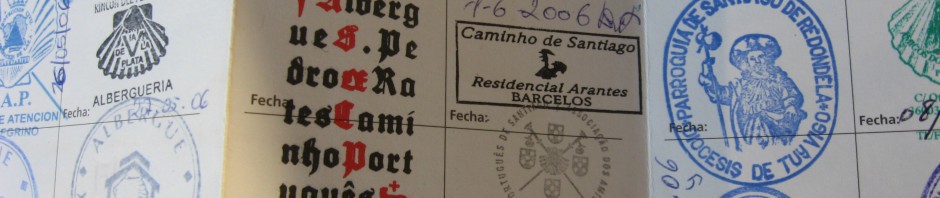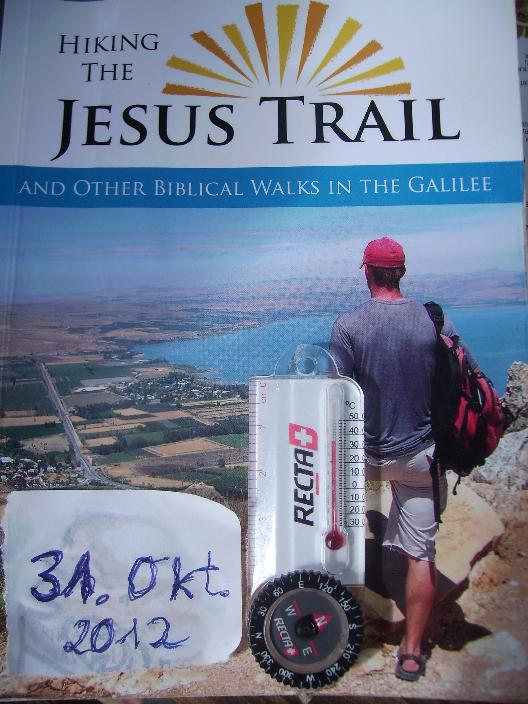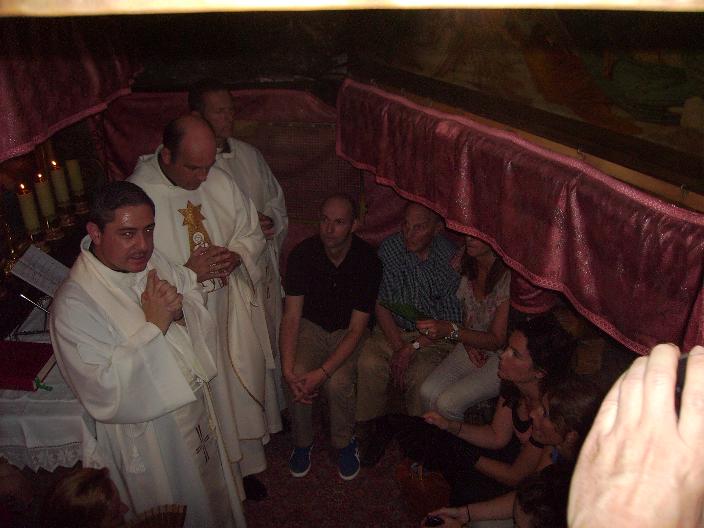Joachim Mauer pilgert nach Jerusalem
PiJo in Jerusalem
07.09.2012 – 06.11.2012
Tagebuch eines Pilgers
E-Mail vom 02.10.2012
Ihr Lieben in Deutschland,
seit 7. September bin ich nun auf Achse. Dieser Weg nach Jerusalem verlief bisher anders als geplant.
Da war zunächst mein Sturz am 3. Marschtag mitten in einer Kleinstadt. Ich hatte ein Loch nicht gesehen, blieb mit einem Fuß darin hängen und stürzte mit Rucksack. Er verstärkte den Aufprall mit Gesicht und Knie. Ich blutete sehr stark. In der sich sammelnde Menschenmenge fand sich schnell ein fachkundiger Samariter, der mit erste Hilfe leistete. Andere brachten Wasser zum Reinigen und zum Trinken. Die Hilfsbereitschaft war beeindruckend. Mein Samariter schickte mich mit Notverband ins Krankenhaus. Eine junge Ärztin nähte die Wunden an Stirn und Knie mit mehreren Stichen. Das anschließende Roentgen zeigte keine Brüche. Ich konnte weitermarschieren und sah die ersten Tage aus wie ein Boxer. Doch die Wunden heilten schnell, die Fäden zog ich mir selbst und es ist wieder alles in Ordnung.
Mein Mitpilger Jean-Pierre bereitete als nächstes Sorgen. Es zeigte sich sehr schnell, dass er den Strapazen nicht gewachsen war. Ich reduzierte die Etappen auf 20 – 25 km. Doch auch dies funktionierte nur mit großer Mühe. Seine Füße in den viel zu engen Schuhen produzierten Blasen, die er mit Compeed versorgte. Dies half nichts. In Benevento war dann Schluss. Nachdem ein Krankenpfleger die Behandlung verweigerte, übernahm ich die Versorgung. Zwei Löcher in beiden Fersen galt es zu versorgen. Da war an ein Weiterwandern nicht zu denken. So folge er mir mit Bus und Bahn. Als die Heilung fortgeschritten war, erneute Wanderversuche. Nach einigen Tagen große Blasen unter den Füssen. Wieder Marschstop für ihn. Bis heute.
Es galt umzuplanen. Er wollte nach Hause. Ich, gewarnt durch meinen Sturz, wollte die große Strecke nicht alleine gehen. Ein neuer Plan entwickelte sich.
Diese Via francigena del Sud von Rom bis Finibus terrae in Santa Maria di Leuca ist ein toller Pilgerweg. Wunderschöne Etappen in den Appeninnen, dann die Ebene von Bari mit den Weinbergen, schließlich mehr oder weniger an der Adria entlang durch Olivenhaine, Obstplantagen, Weinberge oder nur am Strand entlang.
Das alles bei strahlend blauem Himmel und Temperaturen zwischen 30 und 35 Grad. Klar, dass da ein tägliches Bad im angenehm kühlen Meer nicht fehlte. Abends Unterkunft in Klöstern, Kirchen, B+B?s, kleinen Hotels, oft in wunderschönen Hafenstädtchen. Dazu die große Hilfsbereitschaft der Italiener uns sprachunkundigen gegenüber. Ich könnte viel darüber erzählen.
Nun war ich im italienischen Finisterre, habe die Via francigena del Sud somit abgewandert. Gestern fuhren wir mit dem Zug zurück nach Bari. Heute Abend nehmen wir die Fähre nach Igoumenitsa und ab morgen steht Griechenland auf dem Programm. Wir werden runter nach Patras (etwa 300 km) wandern. Dort nehmen wir am 17. einen Ryanairflug nach Paphos auf Zypern, wandern von dort über Nikosia nach Lacarna. Dort fliegen wir am 21. mit der Air Cyprus nach TelAviv. Ein Bekannter aus DED-Zeiten, der Koordinator der Deutschen Entwicklungshilfe, der in Palästina ist und in Jerusalem wohnt, hat uns angeboten bei ihm zu wohnen. Er wird uns auch bei dem anschließenden Aufenthalt beraten. Wie lange wir in Israel bleiben, weiß ich noch nicht.
Der lange Weg über die Türkei ist nur aufgeschoben. Ich werde ihn auf jeden Fall noch machen.
Soweit also mein aktueller Bericht.
Ich wünsche Euch allen eine gute Zeit.
Viele Grüße
Joachim
E-Mail vom 15.10.2012
Hallo, Ihr Freunde und Bekannte in Deutschland,
eine weitere Etappe unseres Weges nach Israel neigt sich dem Ende zu. Am Donnerstag fliegen wir von Patras- Anaxos nach Paphos im Westen Zyperns. 4 Tage haben wir Griechenland von Norden in Richtung Süden durchwandert. Angekommen sind wir mit der Nachtfähre in Igoumenitsa. Wie würden wir ohne Griechischkenntnisse klar kommen? Nach zehn km Wanderung in die Berge hinein, fanden wir in einem Ort eine kleine Gaststätte und wir versuchten es erfolglos mit Englisch und Französisch. ” Ich spreche Deutsch”, sagte die Wirtin, bediente uns mit einer guten Vesper und einem ersten (gut schmeckenden) griechischen Bier. Hilfsbereit, notierte sie uns die wichtigsten Wörter. 30 Jahre hat sie im Ruhrgebiet gearbeitet. Wir erfuhren, dass es im Norden Griechenlands viele gibt, die ab den 1960er Jahren ihr Brot in Deutschland verdienten. Nach weiteren Marschstunden stellte sich am späten Nachmittag die Frage der Unterkunft. Ich sprach in einem kleinen Städtchen ein Ehepaar auf Deutsch an. Flugs suchten Sie für uns ein Fremdenzimmer und der Herbergsvater selbst fuhr uns abends ins 3 km entfernte Restaurant. Viele positive Erlebnisse könnte ich anschließen. Eines möchte ich doch erwähnen. Am fünften Tag kommen wir in einen Ort. Unterkunft Fehlanzeige. Die Freundin des Wirtes, eine Athenerin, versteht Englisch. Mein Mitpilger Jean-Pierre, der wegen Fußprobleme vor mir mit dem Bus angekommen war, erzählt von seinem deutschen Pilgerfreund, der noch zu Fuß unterwegs sei. Als ich dann ankam, zeigte die Athenerin, die mich abgepasst hatte, auf die Kneipe, in der Jean-Pierre auf mich wartete. Kurz darauf kam ein Grieche, der sich in perfektem Deutsch als Petro vorstellte und uns beide mit sich nach Hause nahm. Ein schönes Zimmer erwartete uns und die Gastfreundschaft Petros und seiner Frau. Deutscher Kaffee und leckerer Kuchen. Unsere Wäsche kam in die Waschmaschine und ich, da ich außer einem Handtuch nichts mehr am Leib hatte, wurde mit Petros Klamotten vorübergehend eingekleidet. Zwischendurch stieg Petro mit seinen vorher gewaschenen Füßen in die Traubenkelter und stampfte seine Trauben platt. Abends ein wunderbares griechisches Abendessen und morgens ein deutsches Frühstück. Wir wollten unseren Gastgebern die Unkosten erstatten. Fehlanzeige. Keinen Cent wollten sie. „Für uns Griechen ist Gastfreundschaft eine selbstverständliche Tugend”, so der Kommentar.
So wanderten wir bei Tages- temperaturen von über 30 Grad bis hinunter nach Patras, oft an der Küste entlang. Klar, dass ich mir Zeit zum täglichen Bad nahm. Ein Österreicher sagte mir am Strand vor Preveza, das Meer sei 27 Grad warm.
Über die Meeresbucht nach Patras hinüber fuhren wir mit der Fähre. Wir hätten auch über die 2km lange neue, von den Franzosen gebaute, Brücke gehen können.
Patras ist eine Großstadt. Wir brauchten einen ganzen Vormittag und 13 km um sie zu durchlatschen. Danach noch 15 km in die Berge des Pelepones. Dann kam das Problem, dass wir keine Unterkunft fanden. Ich hätte gerne draußen geschlafen. Doch man warnte uns. Griechenland ist ein Durchgangsland vieler Emigranten. Viele bleiben hier hängen, leben in erbärmlichen Unterkünften am Straßenrand. Arbeiten mit Hungerlöhnen als Hirten oder auf den Feldern. Da entwickelt sich natürlich auch eine gewisse Kriminalität.
So fuhren wir wieder nach Patras zurück, kamen in einem ebenso teuren wie schlechtem Hotel unter und entschlossen uns am nächsten Morgen die 100 km nach Korinth zu fahren. Dort war die Unterkunft wieder einwandfrei und günstig. Am nächsten Tag lud uns ein Pope zur Besichtigung seiner Kirche ein. Beeindruckend die Fülle und Pracht der Ikonen!
Dann waren es nur noch 4 km zum Kanal von Korinth. Und es begann unserer Wanderung “zwischen den zwei Meeren” am Kanal entlang. Beeindruckend dieser Landdurchschnitt und unter uns die schmale Fahrrinne glitzernd. Ab und zu Segel- und Motorjachden und – Gott sei Dank – auch ein größeres Frachtschiff. Der Tag endete mit dem Besuch im alten Korinth, heute Ausgrabungsstätte und Museum. Mein frommer Mitpilger Jean-Pierre war ganz ergriffen, an der Stätte zu sein, wo Paulus seine Briefe an die Korinther schickte, die Eingang in die Bibel fanden.
Mit dem Bus ging es dann wieder nach Patras zurück und am westlichen Standrand setzten wir am gleichen Tag unsere Wanderung in Richtung Süden fort. Diesmal an der Küste entlang. Ein kleiner Umweg zwar, aber mit Aussicht eher Unterkünfte zu finden. In Purgos angekommen, wollten wir auf einen Abstecher nach Olympia nicht verzichten. Zu Fuß natürlich. Jean-Pierre nahm allerdings den Bus. So fuhren morgens die Busse der Kreuzfahrtschiffe, die an der Küste angelegt hatten, an mir in Richtung Olympia vorbei. Manche hupten und zollten mir Anerkennung, der ich schnellen Schrittes zu den olympischen Stätten der Antike unterwegs war. Dort angekommen, wartete schon Jean-Pierre auf mich und wir besichtigten die Reste der Wettkampfstätten.
Nun wollen wir morgen noch nach Kalamata im Süden des Pelepones; denn unser Ziel ist es ja, uns möglichst viel zu Fuß Israel zu nähern. Doch wir werden die 100 km wohl zu 80 Prozent mit dem Bus zurücklegen; anders haut das zeitlich nicht hin. Am Mittwoch geht es dann mit dem Bus nach Araxos, und am Donnerstag nehmen wir den Flieger nach Zypern.
Die Griechen habe ich zu 99 Prozent als freundlich, überaus hilfsbereit und gastfreundlich erlebt. Wirtschaftlich liegt das Land am Boden. 25 Prozent Arbeitslosigkeit, darunter ganz viele junge Leute. Die Alten geben oft von ihrer kleinen Rente den Jungen ein Trinkgeld ab. Ich hoffe, es gelingt, dem Fass ohne Boden einen solchen einzuziehen, dass die Wirtschaft wieder Schubkraft bekommt. Die Griechen wissen sehr wohl, dass sie in der Vergangenheit den Bogen überspannt und Fehler gemacht haben, möchten dies ändern. Aber das geht nicht von heute auf morgen. Die Europäer, sollten den Bogen nicht überspannen. Gerade wir Deutsche haben hier immer noch ein hohes Ansehen. Und Deutschland hat in den vergangenen Jahren auch viel am Export nach Hellas verdient. Einschließlich der Banken. Das wissen auch die Griechen. Vor Angela Merkel haben viele Furcht, aber auch Hochachtung. Bei vielen Begegnungen am Wegesrand und mein Hinweis, dass ich Deutscher sein, fiel sofort das Wort “Merkel”.
Nach dem wir über einen Monat keinen Regen und nur Hitze und Sonnenschein erlebt haben, regnet es ab und an. Gestern hatten wir ein Gewitter und es goss in Strömen. Gott sei Dank fand sich eine Unterstellmöglichkeit
In Deutschland ist es Herbst und Waltraud wird in Mehren wieder den Kachelofen anschmeißen.
Viele Grüße
Joachim (Mauer
E-Mail vom 26.10.2012
Hallo Ihr lieben in Deutschland,
Ihr seht, wir sind in Israel angekommen. Aber der Reihe nach.
Wir haben am 17.10. Griechenland verlassen. Wir haben uns dort wohlgefühlt. Ein letztes kleines Hotel am Strand nahe bei Patras, und am Morgen sind wir dann die 12 km zum Internationalen Flughafen von Patras Araxos gelaufen. Als wir dort gegen 9.30 h ankamen, war noch alles verrammelt und kein Mensch da. Zeit also, meine Wäsche am Eingangsgeländer des Großflughafens zu trocknen und den Rucksack umzupacken. Ich nehme an, die Ryanairmaschine nach Pafos auf Zypern war die einzige Maschine dieses Tages. Mit einer Stunde Verspätung ging es dann gegen 14.30 los. Ein schöner Flug über die ägäische Inselwelt erwartete uns.
Von Pafos hatte ich bis zum Kauf des Flugtickets noch nie etwas gehört. Ich erwartete ein kleines Nest im äußersten Südwesten Zyperns. Schon beim Anflug wurde ich eines anderen belehrt. Eine größere Stadt mit einem schicken Flughafen. Unerwartet für mich. Zypern hat Linksverkehr. Als jemand der marschiert und Rechtsverkehr gewohnt ist, bringt das Probleme. Man schaut immer nach der falschen Seite, denkt, da ist frei und dann kommt von hinten oder vorne, je nachdem auf welcher Straßenseite du bist, ein Auto angeschossen. Es gab da einige brenzlige Situationen. Angenehm war, dass Zypern den Euro hat, was ich auch nicht wusste. Vorschlag an die EU Kommission: Man sollte Ländern, mit Linksverkehr, die den Euro einführen wollen, zur Auflage machen, bei der Einführung auch den Verkehr von links auf rechts umzustellen. Dann weiß man schon im Anflug, es gibt dort den Euro bzw. wenn man mit Euro bezahlen kann, man fährt auf der Straße rechts. (Ein Witz!)
Nach der Ankunft ging es mit dem Bus durch Pafos. Eine Bettenburg wie der Playa auf Malle mit vielen Touris. Nichts wie weg hier in Richtung Nikosia! Eine freundliche Dame am Flughafen hatte uns schon ein günstiges Hotel dort gebucht und uns gleich einen Bündel mit Karten und Prospekte in die Hand gedrückt. Auf einer neuen Autobahn in einem betagten Bus haben wir die 100 km zurückgelegt und konnten auch in der Abenddämmerung feststellen: Diese Republik Zypern ist ein modernes Gebilde.
Nach einigem Suchen fanden wir unser Hotelchen mitten in einer engen Altstadtstraße. Es ist in libanesischer Hand, oben Hotel unten Resto. Für uns prima, nach dem langen Tag plagte uns Hunger und Durst. Wäsche und Dusche wurden verschoben und es ging hinunter auf die Straße, wo die Restauranttische standen. Doch es wurde nicht nur gespeist, sondern auch kräftig Wasserpfeife geraucht. Nachdem unser Hunger gestillt und nach einer Flasche Rotwein der Tagesstress abgestreift war, bestellten wir uns eine Wasserpfeife für acht Euro. Der Ober zeigte uns, wie man kräftig Rauch verbreitet und wir machten es nach. Das Ganze schmeckte ganz gut. Ich hatte schnell genug davon, Jean Pierre schmeckte es noch etwas länger.
Am nächsten Tag ein Ausflug ins moderne Zypern und dann die Fußgängermeile in Richtung Demarkationslinie Checkpoint. Man muss wissen, Zypern ist im Gegensatz zu Deutschland noch geteilt. Die Sachkundigen unter meinen Lesern mögen es mir verzeihen, wenn ich den geschichtlichen Hintergrund kurz erkläre.
Die Bevölkerung der Insel besteht zu 8o% aus griechischen Zyprioten und zu 20 % aus türkischen Zyprioten. Die lebten bis 1974 mehr oder weniger friedlich miteinander. Das damalige Obristenregime in Griechenland betrieb den Anschluss Zyperns an Griechenland. Die Türkei sah sich als Schutzmacht der türkischstämmigen Zyprioten und marschierte in Zypern ein. Es kam zum Krieg mit der anderen Partei. Letztere war unterlegen, und es gelang dem türkischen Militär 40% der Insel und zwar den Norden, zu besetzen. Es kam auf Vermittlung der Uno zu einem Waffenstillstand. 200.000 im Norden ansässige griechische Zyprioten wurden vertrieben und im Norden ein Staat ausgerufen, der international nur von einer Handvoll Staaten anerkannt wurde. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Die Uno überwacht bis dato den Waffenstillstand.
Nikosia ist geteilt und wenn man an der Demarkationslinie entlang marschiert, wird man an Berlin vor 1989 erinnert. Straßenzüge mit zugemauerten Fenstern, Straßen mit vollbetonierten Blechfässern abgesperrt und mit Stacheldraht versehen. Überall Grenzposten mit Maschinengewehren in ihren Wachhäuschen. Auf griechischer Seite hat ein cleverer Kneipenwirt seine Gaststätte direkt an der Grenze hinter einem Grenzposten gelegen, Checkpoint Charly genannt und ein Berliner Bär baumelt als Maskottchen am Eingang.
Erst seit einigen Jahren kann man an einigen Checkpoints auf die jeweils andere Seite gelangen. Einen davon gibt es für Fußgänger in der Innenstadt von Nikosia. Die griechische Seite belässt es beim Übergang bei gelegentlichen Kontrollen. Doch der Norden möchte seine Unabhängigkeit demonstrieren. Verlangt Pass oder Perso und stellt per Stempel oder Wisch ein Einreisevisum aus. Wenn viel los ist, bildet sich eine Schlange. Schikanen gibt es aber nicht.
Da wir Zypern auf unserem Weg nach Jerusalem von Norden nach Süden zu Fuß durchqueren wollten, ging es dann am nächsten Tag früh über die Grenze und zum Bus, der uns nach Girne brachte, der Hafenstadt im Norden. Ein hübscher Flecken mit einem gemütlichen Fischerhafen und vielen kleinen Restaurants drumherum. Kein Massentourismus wie in Südzypern. Man kann zum Beispiel auf einem umgebauten Fischerboot hinaus in die Ägäis schippern, um dort zu schwimmen, zu fischen, zu tauchen oder einfach an Deck sich den Body bräunen lassen. Viele junge Leute, zahlreiche Deutsche darunter, tun dies. Wir widerstanden der Versuchung und machten uns bei 30 Grad Hitze in Richtung Norden auf. Leider liegt direkt hinter Girne ein Klotz von Berg, und wir mussten auf der einzigen Straße, vierspurig ausgebaut, auf diesen Klotz hinaufsteigen und konnten danach diese stark befahrene Straße verlassen, um in der sich anschließenden Ebene Richtung Nikosia zu wandern. Vorbei an fast 8 km Stacheldraht, an einem Gebiet, das für die türkische Armee reserviert ist, die bis heute die eroberten Gebiete militärisch sichert. Freundliches Winken der Soldaten in den Wachposten, die sich sichtlich langweilten. Vor Nikosia eine große Universität und viele Wohnblöcke. Dieser türkische Teil machte auf uns einen dynamischen Eindruck. Allerdings weniger wohlhabend als der Süden. Nach 30 km Marsch sind wir dann wieder in Nikosia angekommen, über den Checkpoint gelangten wir wieder in unser gemütliches Hotel.
Am nächsten Tag nahmen wir den Bus, 10 km nach Süden bis zur Stadtgrenze, um dann unsere Wanderung nach Süden fortzusetzen. Die freundliche Busfahrerin zeigte uns den Weg und konnte gar nicht kapieren, dass man die 30 km bis Larnaka zu Fuß zurücklegen will. Wir taten dies auf einer verkehrsarmen Straße und wurden noch einmal mit der geteilten Wirklichkeit konfrontiert. Hinter Nikosia trennt eine Bergkette den Norden von der Ebene von Lacarna. Ähnlich wie die Israelis auf dem Golan, haben sich die Türken einen Korridor erkämpft bis zu einem der letzten Berge und können von oben den Süden observieren. Links daneben auf dem Berg ein UNO-Kontrollposten und rechts das griechisch-zypriotische Militär und wir am Fuß der Berge schwitzend in Richtung Süden marschierend. Ein Denkmal am Wegrand. Die Tafel erzählt in deutscher Sprache, dass hier kurz vor dem Waffenstillstand 1974 drei österreichische UNO-Soldaten starben. Sie sollten zwischen den Kriegsparteien vermitteln und wurden von der türkischen Luftwaffe mit Napalmbomben getötet,
Doch kommt man nach Lacarna ganz im Süden, hat man die Teilung der Insel wieder vergessen. Eine moderne Stadt und ein wunderbarer Strand. Ich konnte der Versuchung nicht widerstehen, mich in die Wellen zu werfen.
Zum Flughafen waren es dann nur noch 7 km, ebenfalls zu Fuß zurückgelegt. Abends um 20:30 Uhr ging es mit einer Maschine der Cyprus-Airlines Richtung Ben Guerion Flughafen in TelAviv-Israel. Nach Italien, Griechenland und Zypern und 54 Tagen Marschierens trennten uns nur noch Stunden von unserem Ziel. Uff!
Was uns dort erwartete, das erfahrt ihr in meinem nächsten Rundbrief.
Viele Grüße
Joachim
E-Mail vom 07.11.2012
Hallo, Ihr Freunde in Deutschland,
hier ein weiterer Bericht unserer Wander- und Pilgerreise.
Der Flug von Larnaka nach TelAviv war kurz. Da es dunkel war, tauchten im Landanflug die Lichter der Stadt auf und wir waren schon ziemlich niedrig. Jeden Moment mussten wir aufsetzen. Doch plötzlich startete der Pilot wieder durch. Ein erschrockenes Raunen war in der Kabine zu hören. Was war los? Wir gewannen an Höhe. Die Lichter unter uns wurden kleiner und das Schwarz des Mittelmeeres kam zurück. Endlich die Mitteilung des Kapitäns: “Die Landegenehmigung wurde zurückgezogen. Wir gehen in die Warteschleife.“ Zwanzig Minuten mussten wir noch in der Luft bleiben, ehe wir runter konnten.
Ich hatte schon viel von den Sicherheitskontrollen einschließlich den Befragungen der Israels gehört. War also sehr gespannt, was mich erwartete und dann doch angenehm überrascht. Drei kurze und freundliche Fragen an der Passkontrolle (Wo kommen Sie her? Warum kommen Sie noch Israel? Wo werden Sie sich aufhalten?) und schon erhielt ich meinen Pass mit Einreisestempel zurück. Ich passierte mit meinem Rucksack die Zollkontrolle, ohne angehalten zu werden. Ich fragte mich: „Hat man mich falsch informiert?“ Im Laufe meines Aufenthaltes sollte ich noch erfahren, dass Militär und Sicherheitsbehörden auch anders können. Davon jedoch später.
Ich muss gestehen, dass ich mich auf meinen Aufenthalt in Israel und Palästina nicht vorbereitet hatte. Ich lasse gerne so etwas auf mich zukommen. Als Kontaktperson hatte ich Rudolf Rogg, den Leiter der Deutschen Entwicklungshilfe für Palästina. Ich habe ihn in meiner Afrikazeit kennengelernt und durch Zufall erfahren, dass er vor Ort ist. Seine Sekretärin Rania (eine liebenswerte Palästinenserin) hatte für den ersten Tag eine Unterkunft im Pilgerhaus der Österreicher in der Jerusalemer Altstadt und weitere Tage im Gästehaus der lutherischen Kirche auf dem Ölberg reserviert.
Als wir das Flughafengebäude verließen war es mittlerweile 22.00 Uhr Ortszeit. Rudolf hatte uns gemailt, wie wir einen Bus finden, der uns die 60 km nach Jerusalem bringt. Der fährt aber erst los, wenn alle Plätze besetzt sind, was nach 45 Minuten der Fall war. Mit einem ziemlichen Tempo fuhr er auf der Autobahn durchs nächtliche Israel. Kurz vor Jerusalem war die Straße auf beiden Seiten mit hohem Stacheldraht versehen und dann sahen wir zum ersten Mal diese hohe Mauer, die seit einiger Zeit an der Grenze zu den und in den palästinensischen Gebieten gebaut wird. Erinnerungen an die Teilung Deutschlands und insbesondere Berlins wurden bei mir wach.
Wir stiegen am Damaskustor aus. Heute weiß ich, dass es eines der Tore ist, über die man in die Jerusalemer Altstadt gelangt. Es ist das östliche Tor und stellt die Verbindung des arabischen Teil Jerusalems mit dem arabischen Teil der Altstadt her. Mittlerweile war es kurz nach Mitternacht. Es war nicht mehr viel los. Wenige Händler waren mit dem Einpacken ihrer Waren beschäftigt und die letzten Müllwagen verließen die Altstadt. Ein Freiwilliger des Pilgerhauses holte uns am Tor ab und brachte uns zur Herberge, die an der Via Dolorosa liegt.
Jean-Pierre, mein Mitpilger und ich, wir waren noch ziemlich aufgewühlt. Immerhin war der Tag lang: Über 30 km in Südzypern gewandert, Flug, Fahrt hierher. Kurzum, wir hatten noch Lust auf ein Bier. Fehlanzeige! Die wenigen arabischen Gaststätten, die noch auf hatten, boten keinen Alkohol an. Zurück in die Herberge. Die Tageshitze war aus unserem Zimmer noch nicht ganz verschwunden. Für die Stechmücken eine willkommene Gelegenheit, sich hier einzufinden und uns zu pieken. Zwischen den Stichen gab’s eine Handvoll Schlaf bis der Muezzin morgens um 4.30 Uhr über Lautsprecher zum Gebet rief und uns gleich mit aufweckte.
Gott sei Dank schliefen wir danach noch mal ein. Beim Aufstehen, dann ein Super-Erlebnis. Zunächst durch unser Fenster und gleich danach vom Dach der Herberge schauten wir auf die Altstadt hinab, die im Licht der Morgensonne lag. Die goldene Kuppel des Felsendomes lachte uns an. Die verwinkelten und ineinander geschachtelten Häuser und die zahlreichen Kirchen. Moscheen und Synagogen schauten mich noch etwas verschlafen und friedlich an. Ich war überwältigt.
Ein günstiger Moment, das sogenannte Beweisfoto zu knipsen. Also packten wir wieder unseren Rucksack, schleppten ihn auf das Dach der Herberge und stellten uns mit ihm, die Altstadt und den Felsendom im Hintergrund in Pose. Knips und der Beweis war im Kasten: Wir haben unser Ziel erreicht.
Fortsetzung folgt.
Viele Grüße
Joachim (Mauer)
E-Mail vom 08.11.2012
Hallo, Ihr Freunde,
hier ein weiterer Bericht unserer Wander- und Pilgerreise.
Wie ich bereits geschrieben habe, liegt die Pilgerherberge der Österreicher unmittelbar an der Via Dolorosa, dem „Leidensweg“ Jesu Christi. Sie beginnt am Nord-westlichen Lions Gate (Löwentor). Von dort schaut man hinab nach Gethsemane am Fuße des Ölberges, wo der Messias die letzten Stunden vor seiner Festnahme verbrachte.
Die Via Dolorosa liegt vorwiegend im muslimischen Teil der Jerusalemer Altstadt. Sie ist dort einige von vielen Sträßchen, in denen sich das Leben des Basars abspielt. Nicht viel breiter als ein normaler Fußgängerweg, gesäumt von den Geschäften und Läden, in denen man alles findet: Gewürze, Andenken, Fladenbrotbackstuben, Lebensmittel, Massen von Obst und Gemüse, Saftpressen, kleine Restaurants, Internetcafés, Elektronik, Teppiche, Kleidung, Alteisen, Werkzeug, Haushaltsgeräte, Friseure usw., usw. und in erreichbaren Abständen, im allgemeinen recht saubere öffentliche Toiletten. Würde man sich die Touris und Pilger wegdenken, wären die Sträßchen, darunter die Via Dolorosa, wohl gefüllt mit Einheimischen: Arabische und jüdische Frauen beim Einkaufen mit Nachwuchs an der Hand und/oder im Kinderwagen. Arabische Männer in kleinen Gruppen beim Palavern oder am Rand sitzend, den Rauch aus einer Wasserpfeife in die Luft blasend und das Straßengeschehen meist amüsiert und kommentierend aufmerksam beobachtend.
Jüdische Bart tragende Männer jeden Alters, viele Kinder (noch ohne Bart), alle mit der traditionellen Kleidung: Schwarzer Anzug, weißes Hemd, schwarze Schuhe, Hut mit mehr oder weniger breiter Krempe oder massiver Pelzmütze, darunter quellen die langen Locken hinab. Bänder am Gürtel hinab hängend. Manchmal haben sie ihre Frau im Schlepptau: Einfache dunkle Kleidung. Nichts für Carl Lagerfeld. Der wäre bei ihnen ein armer und unbedeutender Mann. Alle hasten sie in Richtung Klagemauer. Die Eile entspringt ihrem Wunsch, möglichst schnell dort zu sein, um viel Zeit zum Beten zu haben. Oft bleibt dennoch Zeit zu einem Einkauf bei einem arabischen Geschäftsmann. Man begegnet sich distanziert, aber nicht feindlich.
Die Versorgung des Basars mit Waren und der Abtransport des täglichen Mülls ist eine Herausforderung, die gemeistert wird. Ständig fahren meist junge kräftige Kerle vierrädige Kastenwägelchen in der Größe eines Leiterwagens hoch beladen in die Altstadt
hinein. Da geht es bergauf und bergab. Gebremst wird mit einem Autoreifen, der am Wägelchen mit einer Kette befestigt, hinterher schleift. Geht es abwärts, stellt sich der Chauffeur auf den Reifen und bremst ab. Eine einfache, aber wirksame Lösung. Die Mülltraktoren mit Anhänger stammen aus Deutschland, wo man sie bei Forstarbeiten einsetzt. Am späten Nachmittag rücken die an und um Mitternacht ist die Altstadt clean.
Wie gesagt, wäre die Via Dolorosa nur mit Einheimischen bestückt, so käme sie oft an die Grenze ihrer Kapazität und nun kommen noch die Touristen und die Pilger einzeln oder in Gruppen dazu, unter ihnen gibt es nämlich so gut wie keinen, der den Leidensweg ( ich schätze nicht mehr als 500 m lang) nicht persönlich ablaufen möchte.
Ich denke, dass das Sträßchen unter all den heiligen Stätten, am authentischsten ist. Man sagt sogar, dass an einigen Stellen der Straßenbeleg (große flache Steine) noch aus der Zeit Jesus stammt. Man folgt förmlich seinen Fußstapfen. Es war ein ebenso grausamer wie kluger Schachzug, dass die damaligen weltlichen und religiösen Machthaber diesen unbequemen und überaus erfolgreichen Wanderprediger nach seiner Verurteilung Kreuz tragend durch diese belebte Gasse schickten sozusagen zur Abschreckung und Demonstration ihrer Macht.
Heute gehen zahlreiche Pilgergruppen diesem Weg nach. Ein leichtes, einfaches, durch den häufigen Gebrauch abgegriffenes (und für eine Kreuzigung ungeeignetes) Kreuz kann man ausleihen. Oft wechseln die Kreuzträger von Station zu Station. Dahinter folgt die fromme Pilgergruppe oft von einem Priester, Popen oder Ordensmann angeführt. Sie kommen aus allen Teilen unserer Erde: Nord-, Mittel oder Südeuropäer, Nord- oder Lateinamerikaner, Asiaten und Australier, Katholiken, Lutheraner oder Orthodoxe. Singend oder betend schieben oder drängen sie sich den Leidensweg hinauf. Meist umringt von Touristen, die das Ereignis unbedingt mit Fotoapparat, Filmkamera, Handy, Laptop mit Fotosoftware einfangen wollen. Da muss man schon ein abgehärteter und erprobter Pilger sein, um sich da noch zu konzentrieren. Das Singen und Beten geht oft unter im allgemeinen Lärm.
Mein frommer Mitpilger Jean-Pierre hatte sich so darauf gefreut, den Leidensweg seines göttlichen Freundes meditierend und betend folgen zu dürfen. Sozusagen als Abschluss seiner Leiden auf dem Weg von Rom nach hier mit 16 großen Blasen und zeitweise Löchern in den Füßen und zahlreichen blutunterlaufenen und abgestorbenen Fußnägeln sowie zeitweise großer Erschöpfung rappelte er sich immer wieder auf. Nun am Ziel angekommen, musste er feststellen, dass der ganze Jesusrummel, nicht dem entsprach, was er sich vorgestellt hatte.
Die Via Dolorosa führt auf ihrer Zielgerade in die christliche Altstadt und mündet in die Grabeskirche. Diese Kirche beinhaltet den Kreuzigungsort, das Grab und die Wasch- und Salbungsstätte nach der Abnahme Christi vom Kreuz. Letztere ist für die orthodoxen Christen von großer Bedeutung. Frauen knien dort nieder, scheuern den Stein, wo Christus gelegen haben soll. mit Tüchern blank, bevor sie ihn küssen.
Zur Rechten liegt Golgatha, heute in eine Kapelle integriert. Lange Schlangen stehen an der Seite und warten auf Einlass. (Kann in Spitzenzeiten bis zu 2 Stunden dauern.) Ein orthodoxer Kirchenmann drängt die Gläubigen hinein: „Go! Go! Go!“ Ein kurzer Blick drinnen, ein Foto und schon wieder heraus: „Go! Go! Go! “Hinab geht’s in eine Krypta, in der der Leichnam Jesu vor seiner Wiederauferstehung lag. Es gibt Zweifel, ob sich das Lebensende und die Wiederauferstehung Jesu wirklich hier abgespielt hat. Es war wohl die hl.Helena, die Mutter des römischen Machthabers Konstantin, die anlässlich eines Jerusalembesuchs recherchierte und dann diese Stätte festlegte. Die Evangelisten glauben dies nicht. Sie sind der Meinung, dass Kreuzigungsort und Grab außerhalb der Stadt liegen; denn Exekutionen fanden damals außerhalb der Stadtmauern statt.
Nun gut. Heute teilen sich Äthiopisch-Orthodoxe, Armenisch-Apostolische, Römisch-Katholische, Griechisch-Orthodoxe, Kopten und Syrisch-Orthodoxe die Grabeskirche und haben sich in der Vergangenheit wie die Berserker über Aufgaben und Kompetenzen gestritten – gelegentlich auch handgreiflich, was dazu führte, dass heute alles genauestens geregelt ist. Seit mehreren Generationen hat ein Moslem die Schlüsselgewalt über die Kirche. Eine weise Entscheidung, wie ich finde.
Die Jerusalemer Altstadt hat auch für Juden und Moslems enorme Bedeutung. Der Tempelberg, der immerhin fast ein Fünftel des Altstadt einnimmt, ist für die Juden der Ort, an dem Abraham auf Gottes Weisung seinen Sohn opfern sollte und der Tempel stand, in dem die Bundeslade mit den Gesetzestafeln aufbewahrt wurde.
Für die Moslems ist es der Ort, von dem aus Mohamed bei seiner nächtlichen Reise auf einem geflügelten Pferd die sieben Himmel durchquerte und zum Paradies aufstieg.
Auf der riesigen Plattform befindet sich die Al-Sakra Moschee (Felsendom) und am Fuße der große Platz mit der Klagemauer. Nur über völlig getrennte Zugänge können Juden zur Klagemauer und Moslems zum Felsendom. Oft gibt es dennoch handgreifliche Auseinandersetzungen und die Juden versuchen den Tempelberg zu erstürmen. Deshalb ist für Besucher am Wochenende kein Besuch möglich.
Will man als Besucher zur Klagemauer, so muss man sich ebenfalls der Sprengstoffkontrolle unterziehen. Ich hatte den Eindruck, dass die Kontrolle laxer gehandhabt wurde, als beim Zugang zum Felsendom.
Judenkäppchen liegen zum kostenlosen Ausleihen bereit und wenn man eine solche Kippa aufsetzt, kommt man bis zur Klagemauer heran. Aus dem Fernsehen kennt man das ja, aber für mich war es dennoch faszinierend: Getrennt nach Männer und Frauen beten die Gläubigen vor der Mauer, stecken kleine Gebetszettelchen in die Ritzen und bewegen in recht schnellem Tempo ihren Oberkörper vor und zurück. Einige haben eine Schriftenrolle aufgerollt, die in einem silbernen Gefäß aufbewahrt wird und ein Schriftgelehrter singt Textstellen vor.
Neben der Klagemauer befindet sich in einem großen Gewölbekeller eine riesige Bibliothek. Viele sitzen davor und lesen. Andere stehen in Gruppen zusammen und beten mit mehr oder weniger heftigen Oberkörperbewegungen. Als Besucher konnte ich überall herumgehen. Niemand hat sich daran gestört.
Der ganze Bereich wird vom Militär überwacht. Einmal fand eine Räumung statt. Warum war mir nicht ersichtlich und nach 10 Minuten war der Spuk vorbei. Westlich der Klagemauer schließt sich das jüdische Viertel der Altstadt an. Feine Geschäfte, Restaurants, Bildungsstätten (oft von reichen amerikanischen Juden gesponsert), Hotels, Synagogen vermitteln den Eindruck, besonders wenn man aus dem islamischen Viertel kommt, man sei in einem anderen Film. Dagegen ist das sich anschließende armenische Viertel eher bescheiden. Viele Wohnhäuser, einige Geschäfte, das Patriarchat, der Friedhof und die St.James Kathedrale.
Im christlichen Viertel fällt das große Franziskanerkloster auf. Dieser Orden spielt an vielen heiligen Stätten eine große Rolle. Sieht man von Assisi ab, habe ich noch nie so viele Franziskaner gesehen, wie an den heiligen Stätten in Israel.
Ich gestehe, mich hat dieses enge Nebeneinander von sehr unterschiedlichen Menschen und Religionen fasziniert. Allerdings fühlte ich mich unter den vielen Touristen mehr und mehr unwohl. Man muss die Altstadt erlebt haben. Aber dann ist es auch gut und genug.
Viele Grüße Joachim
E-Mail vom 09.11.2012
Liebe Freunde,
ein weiterer Bericht meiner Pilgerreise: Augusta Victoria, Westjerusalem und Yad Vachem.
Nur eine Nacht blieben wir in der österreichischen Pilgerherberge und zogen dann auf den Ölberg um. Dort auf der höchsten Stelle Jerusalems, 850 m /fast 1300 m über dem Toten Meer gibt es den Augusta Victoria Compound mit Krankenhaus, der evangelischen Himmelfahrtskirche und dem Pilger- sowie Begegnungszentrum einschließlich Gästehaus. Ein nicht geringerer als der deutsche Kaiser Wilhelm II versprach 1898 den deutschen Bewohnern Palästinas die Errichtung eines Krankenhauses. Dieses und die Himmelfahrtskirche wurden in den Jahren darauf erbaut. Außer Sand, Kalk und Stein wurde alles Bau- und Einrichtungsmaterial aus Deutschland importiert.
Heute ist das Krankenhaus eine Spezialklinik für Krebskranke aus den palästinensischen Gebieten. Nach dem Bau des „Walls“ kommen weniger Kranke, da insbesondere deren Angehörige oft keinen Passagierschein bekommen. Man überlegt diese alt ehrwürdige Einrichtung auf palästinensisches Gebiet zu verlegen. Der Turm der Himmelfahrtskirche ist eines der Wahrzeichen Ost-Jerusalems. Macht man sich die Mühe, ihn zu besteigen, hat man einen wunderbaren Blick auf Jerusalem und hinüber ins Jordantal.
Für die Tage, in denen wir in Jerusalem übernachteten, kamen wir im Gästehaus unter. Wir waren wohl etwas weit weg vom Schuss. Dafür wir der Preis moderat und wir genossen die Ruhe und die Gastfreundschaft von Ibrahim, dem Verantwortlichen der Herberge. Wir freuten uns jeden Morgen auf sein palästinensisches Frühstück u.a. mit Schafskäse, lecker gewürztem Quark sowie Tomaten und Gurken.
Rasch fanden wir heraus, wie wir schnell hinunter zum Damaskustor kamen. Da fuhren die Kleinbusse mit der Nr.75 oder man hielt einfach ein Auto an. Die Fahrer von Privat-KFZ nehmen gerne Passagiere mit und man zahlt dafür den Preis für den Bus (5 Schekel = 1 €). Dreien ist damit gedient: Dem Passagier, der nicht lange zu warten braucht, dem Chauffeur mit einem Zubrot und der Umwelt.
Nach dem Umzug auf den Ölberg (der heute ein dicht besiedelter Stadtteil in Ost-Jerusalem ist) stand für uns ein Besuch der Yad Vachem (Holocaust) Gedenkstätte im äußersten Westen der Stadt auf dem Programm. Mit der neuen, pikfeinen Straßenbahn ging es vom Damaskustor hinauf zur Jaffastraße (so was wie der Berliner Kuhdamm) im modernen Teil der Stadt.
Es ist unglaublich. Es dauert genau eine Haltstelle und man ist in einer anderen Welt. Moderne Gebäude, schicke Läden, Straßencafés, so wie wir es auch bei uns kennen. Europäisch gekleidete Bewohner flanieren, kaufen ein oder sitzen in den Cafés. Mit einer Kippa zeigen viele, dass sie jüdischen Glaubens sind, aber eher von der moderaten Art, die streng Gläubigen sind in der Minderheit.
Auch zahlreiche Israelis, arabischer Abstammung sind zu sehen. Darunter jungen Frau, die ein wahrer Blickfang sind. Obwohl die Haare komplett unter einem Kopftuch bedeckt, das gleich auch noch die Ohren und den Hals versteckt, lacht einem ein gut gepflegtes und leicht geschminktes Gesicht entgegen. Ein Kleid bis zum Knöchel hinab und lange Ärmel bedecken vollständig weibliche Reize einerseits und betonen sie auch wieder. Hübscher Schmuck wie Halsketten und Armreifen vervollständigen ihr Aussehen zu einer wahren Augenweide. Ich bin begeistert.
Nicht wenige dieser Musliminnen, die ich unter zwanzig schätze, haben schon ein oder zwei Kinder. Der Ehemann und Vater ist oft dabei und wenn man aufmerksam hinschaut, sieht man oft Zuneigung, die die beiden untereinander und mit ihren Kindern verbindet. Vereinzelt traut man sich auch Händchen haltend in die Öffentlichkeit.
Ich frage mich: Diesen Leute egal ob jüdischer, arabischer oder sonstiger Abstammung geht es so wie uns. Sie wollen ihr Leben leben, friedlich und möglichst gesund. Sie lieben ihre Familie, haben Freunde. Warum gelingt es der Politik bis heute nicht, dieser Krisenregion zu einem dauerhaften Frieden zu verhelfen?
Nach einer recht langen Straßenbahnfahrt und einem Fußweg erreichen wir Yad Vachem. Ich zähle über dreißig Busse auf dem Parkplatz.
Vorausschicken muss ich, dass ich im Frühjahr das Holocaust Museum in Berlin besucht habe. Dabei wurde mir mal wieder bewusst gemacht, was die Nazis und deren Unterstützer den deutschen und europäischen Juden angetan haben. Es ist unglaublich, was diese Menschen verachtenden Verbrecher anrichteten. Die in Berlin gezeigten Familienschicksale haben mich tief bewegt. Ich habe mich in ihre Situation versetzt: Anfänglich ausgegrenzt, dann an den Pranger gestellt, ihres Hab und Gutes beraubt, in Viehwagen nach Auschwitz verfrachtet, an der Rampe selektiert, würdelos entkleidet und ins Gas geschickt. All dies ohne Schuld! Unglaublich.
Das ging mir im Kopf herum, als ich Yad Vachem betrat. Und doch war es anders als in Berlin. Dort war ich in meiner Heimat, die Mitbesucher waren meist Deutsche wie ich, darunter viele Schulklassen.
In Yad Vachem war ich in Israel und die Mitbesucher kamen aus vielen Nationen. Und es waren viele junge israelische Soldaten anwesend, für die ein Besuch des Museums im Rahmen ihrer dreijährigen Wehrpflicht (Frauen 2 Jahre) zum verbindlichen Ausbildungsprogramm gehört.
Ich betrete das Museum und erlebe in einem fremden Land mein eigenes in einem der dunkelsten Kapitel seiner Geschichte: Landschaften, Städte, Straßen, Autos, Eisenbahnzüge, Gebäude, Menschen, Stimmen, Schreie, Getriebene, Gehängte, Vergaste, Leichenberge.
Ich habe mir immer wieder gesagt, das ist ein anderes Deutschland. Dennoch fühlte ich mich außerordentlich unwohl und bildete mir ein, dass die um mich herum auf mich zeigen und anklagen: „Du bist doch auch ein Deutscher! Das Ganze habt ihr angerichtet!“
Ich bin dann durch das Museum geeilt. Wollte einfach nur raus. Das geht aber nicht. Die Räume sind so angelegt, dass man erst raus kommt, wenn man alles durchschritten hat.
Draußen habe ich dann meine Gedanken sortiert: Mich trifft keine Mitschuld; denn ich bin erst danach geboren. Auch meine Familie hat unter den Folgen zu leiden: Mein Vater muss nach seiner Heirat 1944 an die russische Front und gerät anschließend in Gefangenschaft. Erst 1949 kommt er zurück und sieht mich als Vierjährigen zum ersten Mal. Das Haus meiner Großeltern wird bei einem Großangriff auf Mainz im Februar 1945 zerbombt.
Ich habe in Yad Vachem vermisst (oder ich habe es nicht gesehen), dass man auch den deutschen Widerstand gezeigt hätte: Stauffenberg mit seinen Leuten. All jene, die unter großer Gefahr jüdische Mitbürger versteckten. Und all jene, darunter viele Geistliche, die offen oder verdeckt, sich gegen die Nazis wandten. Zu welchem Schluss komme ich nach dem Museumsbesuch? Ich bin nicht mitschuldig. Sehe mich aber in der Pflicht, meinen Beitrag zu leisten, dass so etwas in unserem Land nie wieder geschieht. Es beruhigt mich, dass ich da einiges in meinem Leben vorzuweisen habe: Mir war es immer wichtig, mich politisch und sozial zu engagieren, Toleranz groß zu schreiben und gegen Vorurteile anzukämpfen und solche Dinge auch meinen Schülern mit auf den Weg zu geben.
So viel zum Thema Yad Vachem. Auf der Rückfahrt besuchten wir den Markt Mahane Yehuda. Dieses üppige Angebot an Lebensmitteln und insbesondere Früchten ist enorm. Es war Feierabendzeit und deshalb besonders viel los. Ich habe mich mit Jean-Pierre in eine kleine Kneipe gesetzt. Eine Israelin macht mir Platz. Gerne hilft sie uns beim Bestellen; denn wir wollen nur einheimisches Bier. Mit vielen komme ich in Blickkontakt. Meist ein freundliches Zunicken oder ein gerufenes Hello.
Ich wäre gerne noch länger geblieben. Doch es war schon dunkel (um diese Jahreszeit bereits gegen 17 Uhr). Also fuhren wir weiter mit der Straßenbahn zum Damaskustor. Dort in der Nähe haben wir ein hübsches, arabisch geführtes Restaurant gefunden mit gutem Grillfleisch und palästinensischen Beilagen. Außerdem haben die einen guten israelischen Rotwein.
Zu Fuß und schnellen Schrittes geht es danach die knapp zwei Kilometer hinauf zum Ölberg. Einige Kalorien können wir dabei wieder abbauen. Unser Zimmer im Gästehaus sprühen wir mit einem Insektizid gegen Mücken aus. Ich weiß, wenig gesund und umweltfreundlich! Doch die Nacht zuvor waren wir lange auf Stechmückenjagd. Ich treffe mich mit Jean-Pierre im Tagesraum zu unserem allabendlichen Ritual: Was war am heutigen Tag positiv, was war negativ? Knapp zwei Stunden waren wir darüber noch im Gespräch.
Viele Grüße
Joachim (Mauer)
E-Mail vom 12.11.2012
Liebe Freunde,
heute sende ich Euch meinen Bericht über die Reise ans Tote Meer und in den Negev. Jean-Pierre und ich wollten natürlich viel vom Land sehen. Ersterer mehr die Stätten des Wirkens seines göttlichen Freundes. Mir war dies nicht ganz so wichtig. Ich wollte auch andere historische Stätten, sowie Land und Leute kennenlernen und möglich viel über den politischen Brennpunkt Israel und Palästina erfahren. Letzteres kann man am besten, wenn man zu Fuß geht und/oder öffentliche Verkehrsmittel benutzt.
Als Wanderer begegnet man den Leuten auf „Augenhöhe“, und man geht an ihnen im Allgemeinen nicht vorbei, ohne einen Gruß, ein Hallo oder ein paar Worte. Oft fragt man nach dem Weg oder nach anderen Dingen. Oder man wird vom Gegenüber angesprochen: Was macht ihr zu Fuß hier? Wo kommt ihr her? Was ist Euer Ziel? Unzählige Gespräche haben sich daraus schon ergeben. In Bus, Bahn oder Sammeltaxi ist dies oft nicht viel anders. Es ist als würde man ein Buch aufschlagen und darin lesen. Selbst wenn man die Landessprache nicht spricht, wenige Brocken und viel Körpersprache reichen vielfach, schaffen lustige Situationen und verhelfen dennoch zu interessanten und wichtigen Einblicken.
Dennoch, zum Wandern und oft auch für öffentliche Verkehrsmittel muss man Zeit mitbringen und nach knapp zwei Monaten auf Schusters Rappen hatten wir auch unsere Rückkehr im Auge.
Es war mein Bekannter Rudolf Rogg, der Direktor der Deutschen Entwicklungszusammenarbeit für Palästina, der mir nach einem köstlichen Abendessen mit palästinensischer Küche im Restaurant des Hotels „Jerusalem“ im arabischen Ostteil ein Prospekt in die Hand drückte. Der Hotelbesitzer (übrigens mit einer deutschen Frau verheiratet) bietet Fahrten mit einem 12-Sitzer Kleinbus zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten an. Man wird dorthin gefahren. Der Fahrer gibt mit ein paar Sätzen auf Englisch einige kurze Informationen und den Zeitrahmen. Für die Besichtigung ist man selbst verantwortlich.
Normalerweise läuft so was ja anders. Die allermeisten Israeltouristen und/oder Pilger haben organisierten Reisen gebucht. Ein Großteil sind jüngere / mittlere/ betagte Senioren, die in klimatisierten Bussen durchs Land kutschiert und in ihrer Sprache von einem Führer, der Fähnchen oder Schildchen schwenkend vorausmarschiert, durch die Sehenswürdigkeit geschleust werden. Ich finde dies auch total in Ordnung. „Jeder geht SEINEN Weg“, heißt es nicht umsonst in Jakobspilgerkreisen.
Außerdem hat ein solches Reisen in Israel und Palästina diesseits und jenseits des Stacheldrahtes, der Mauer und der Checkpoints (man sagte mir, es gäbe 80 im ganzen Land) den Vorteil, dass man relativ wenig davon mitbekommt. Denn Militärs und Polizei winken oft durch oder beschränken sich auf eine Kurzinspektion oder – besonders in angespannten Zeiten – schauen sich die Pässe an. Da die meisten Busse an die Frontscheibe ein Plakat geklemmt haben, das Auskunft gibt, welche Truppe sich darin befindet und woher sie kommt, kann es schon sein, dass die Kontrolle unterschiedlich ausfällt. US-Amerikaner haben da meist die besten Karten.
Rania, die Mitarbeiterin von Rudolf war es wieder, die uns die Fahrten mit dem „Hotel Jerusalem“ Kleinbus organisierte. Wir wollten zunächst hinunter zum Toten Meer, nach Masada in der Negevwüste und zum Schluss nach Jericho. Fahrten finden jedoch nur statt, wenn eine Mindestkapazität vorhanden, und das entscheidet sich oft recht kurzfristig. Rania, im Autonomiegebiet Westjordanland wohnend, schickte mir am Vorabend eine SMS. Der Sprachschnipsel mit der wichtigen Information, dass am nächsten Tag gefahren wird, fand nicht den Weg (Luftlinie 20 km) auf mein Handy.
Wir sitzen also am nächsten Tag gemütlich bei Ibrahims Frühstück im Gästehaus auf dem Ölberg und unten am Damaskustor wartet der Bus auf uns. Der Fahrer telefoniert mit Rania und diese mit mir. Wir sollten uns schnell ein Taxi nehmen und hinkommen. Während wir uns in aller Eile reisefein machten, eine zweiter Anruf: „Ihr werdet abgeholt.“ Und tatsächlich, 10 Minuten später stiegen wir in unser Reisegefährt. Unsere Mitreisenden, die ja mittlerweile fast 45 Minuten gewartet hatten, nahmen es offensichtlich gelassen. Vorwurfvolle Blicke konnte ich nicht feststellen. Gott sei Dank.
Unser flotter, palästinensischer Fahrer fuhr uns in östlicher Richtung aus Jerusalem hinaus. Auf einer vierspurigen Straße ging es 35 km immer bergab. Rasch verschwand die Stadt mit ihrer dichten Besiedlung und die Landschaft wurde kahl. Auf beiden Seiten der Straße sahen wir immer wieder armselige Bretterverschläge, in denen Hirten mit ihren Familien hausten. Plötzlich war es da, das Tote Meer und wir befanden uns 420m unter dem Meeresspiegel. Leider ließ sich unser Bus nicht in ein Tauchboot verwandeln; denn mit ihm hätten wir uns – am Toten Meeresgrund angelangt – stolze 794 m unter dem Meeresspiegel befunden.
Die Straße führte dann in einiger Entfernung in südlicher Richtung an der westlichen Seite entlang. Der Uferbereich war zunächst Kilometer weit mit einem Zaun abgetrennt. Wahrscheinlich Sperrzone, denn Jordanien liegt östlich des Toten Meeres und die Grenze bildet dessen Mitte. Der Übergang zur Negevwüste war gleitend; denn auf beiden Seiten des Jordangrabens, in dem sich das Tote Meer befindet, liegen Gebirgszüge prägnant, bizarr, zerklüftet und fast ohne Bewuchs. Je nachdem wie die Sonne steht ist dies ein beeindruckendes Landschaftsbild. Etwas über 50 km fährt man vom nördlichen bis zum südlichen Ende des Toten Meeres, vorbei an einigen Oasen, Hotels und Zugängen zum Strand.
Unser Ziel war Masada, ein isolierter Tafelberg, 400m über dem Toten Meer und heute UNESCO Weltkulturerbe. Warum? Schon lange vor Christi Geburt hat man auf diesem Klotz eine kleine Festung errichtet. Es war kein Geringerer wie der berühmt, berüchtigte König Herodes, dem man sogar den Titel „der Große“ verliehen hat, der dort zwischen 40 und 30 v.Chr. eine pompöse Festung errichtet hat, die in ihrer Zeit als uneinnehmbar galt. Er vergaß nichts: Für sich luxuriöse Paläste, teilweise in den Berghang hinein gebaut mit Badehäusern und Schwimmbecken. Zu seiner und der Festungsbewohner Versorgung gab es riesige Lagerhäuser, für die Militärs eine Kommandantur, Pferdeställe und zahlreiche weitere Gebäude. Und da Wasser in der Wüste eher Mangelware ist, ließ er riesige Wasserzisternen anlegen und das Wasser durch Aquädukte heranführen.
Hut ab, vor dieser Glanzleistung damaliger Baumeister. Da steckt viel Knochenarbeit drin. Ich frage mich nur, wie viele einfache Arbeiter (Sklaven?) wurden da verbraucht, verletzt, verkrüppelt und getötet?
Dieser Herodes muss ganz schön Schiss gehabt haben, dass es ihm mal an den Kragen geht. Sonst hätte er sich nicht so verbarrikadiert. Außerdem zog er es auch in Friedenszeiten vor, den Winter auf dem angenehm luftigen Wüstentafelberg zu verbringen, anstatt sich im oft feuchten und kalten Jerusalem einen königlichen Schnupfen zu holen.
Das Ende von Masada war dramatisch. Herodes war schon einige Jahrzehnte tot. Die Römer hatten schon seit einiger Zeit das Sagen. Rebellen gelang es Masada zu besetzen und sich dort mit ihren Familien einzunisten. Knapp 4000 Soldaten brauchten die Römer, um die Festung zu belagern und dann über eine eigens angelegte Rampe (diese und römische Lagerreste sind heute noch zu sehen) zu erobern.
Die Belagerten beschlossen kurz vor dem Fall, lieber zu sterben als den Römern in die Finger zu fallen. Per Los wurden einige Männer bestimmt, die die Truppe nebst Familien und anschließend sich selbst töten sollten. Als die Römer dann kamen, fanden sie 960 getötete Männer, Frauen und Kinder. Zwei Frauen und fünf Kinder konnten sich verstecken und über das Geschehene berichten. Insbesondere in israelischen Militärkreisen und teilweise bis heute wird die Festung als Symbol des jüdischen Selbstbehauptungswillens gesehen. Ich kann diese Ansicht im Hinblick auf den kollektiven Selbstmord nicht teilen.
Um die Festung zu besichtigen, muss man zuerst einmal 400 m hinauf. Einige wenige scheuen den Aufstieg auf einem kleinen Zickzackpfad nicht. Ich habe sogar welche auf dem Fahrrad hinauf strampeln sehen. Hut ab, bei über 35 Grad im Schatten! Mich hat es in den Beinen gejuckt, ebenfalls hinauf zu marschieren. Doch der Zeitplan unseres Fahrers stand dem entgegen. Bequem ging es mit der „tiefst gelegenen Seilbahn der Welt“ hinauf. Die Besichtigung nahm ich mit Knopf im Ohr und deutschsprachigen Audiogerät in Angriff und immer wieder genoss ich den herrlichen Blick auf das tief unten liegende Tote Meer und hinüber nach Jordanien. Als wir dann wieder in der Talstation waren, fanden wir den Ausgang zunächst nicht; denn clever wurde man in den riesigen Andenkenladen und das Großrestaurant geschleust. Beides gut gefüllt; kein Wunder, ich habe über 40 Busse auf dem Parkplatz gezählt.
Der nächste Programmpunkt interessierte mich sehr: Eine Stunde Strandaufenthalt am Toten Meer mit Möglichkeit zum Baden. Anmerkung des Fahrers: „Bitte nicht länger als 20 Minuten im Wasser bleiben wegen erhöhter Sonnenbrandgefahr!“
Zugangmöglich- keit und der Strand waren wohl höchstens 50 m breit. Zu Beginn ein Kiosk mit schattigen Sitzgelegenheiten, danach ein mit Platten belegter Fußweg vorbei an zahlreichen Duschen und einem großen Thermometer, das 38 Grad anzeigte. Auch die Wassertemperatur stand dabei, die habe ich jedoch vergessen. Ich schätze so um die 30 Grad. Durch den überhasteten Aufbruch am Morgen hatte ich leider keine Badesachen dabei. Doch mein Slip und mein Unterhemd von der Marke „Funktionswäsche“ taten gute Dienste, Ersterer als Badehose und das Unterhemd als Handtuch und Schambedecker beim Umkleiden.
Als ich ins Wasser stieg, konnte ich nichts Besonderes feststellen: Klares Meerwasser. Auf dem Rücken liegend, brauchte ich mich nicht zu bewegen. Ich blieb oben. Mutig wollte ich etwas hinaus- schwimmen, drehte mich um und kraulte. Und da geschah es. Gewohnheitsmäßig ließ ich die Augen offen und schwups hatte ich eine Ladung Wasser in denselben. Spätestens jetzt wusste ich um den starken Salzgehalt; denn meine Sehorgane brannten wie Feuer. Halb blind entfloh ich dieser Salzbrühe und es dauerte einige Minuten bis ich wieder schmerzfrei sehen konnte.
Lange stand ich unter der Dusche, zog mich notdürftig um. Während meine Funktionsbadehose und – Handtuch am Autospiegel unseres Kleinbusses trockneten, trank ich am Kiosk ein Bier. Dem Fahrer wollte ich ein Cola spendieren, der lehnte jedoch wegen eines muslimischen Fastentages dankend ab. Danach waren meine Klamotten trocken und ich konnte sie – noch bevor meine Mittouristen eintrudelten – wieder durch Umziehen auf der Hinterbank ihrem eigentlichen Zweck zuführen.
Weiter ging es in die Oase Jericho. Diese aufstrebende Stadt liegt im autonomen Paläs-tinenensergebiet 15 km nördlich vom Toten Meer im Jordantal. Jericho behauptet von sich, die älteste und triefst gelegenste Stadt zu sein.
Wir parken auf einem übervollen Busparkplatz und gehen in ein Großrestaurant. Anscheinend machen hier die meisten Bustouristen Rast. Gut gefüllte Tische in mehreren großen Sälen verraten dies. Ein reichhaltiges Büffet zum Pauschalpreis füllt auch die größten Mägen.
Sozusagen zur Verdauung kann man auf das Ausgrabungsgelände in Restaurantnähe gehen und Jahrtausend alte Ansiedlungsreste bewundern und gleich daneben mit einer kleinen Seilbahn zum Deir Quarantal, dem Berg der Versuchung, hinüber schweben. Das ist – wenn ich recht informiert bin – jener Berg, auf dem Jesus 40 Tage in der Wüste fastete und heftig vom Teufel in Versuchung geführt wurde.
Die Seilbahn endet an einem Kloster das sich „Monastery of Temptation“ nennt und in den Berg hineingebaut ist. Von dort führt ein Pfad hinauf zur Fasten- und Versuchungsstätte. Ich wäre gerne mal dahin geschwebt. Doch wieder mal fehlte die Zeit. Pech gehabt!
Zeit blieb noch, die Überreste des Hischam-Palastes zu besichtigen. Der Kalif Walid I von Damaskus erbaute diesen prächtigen Palast im 8. Jahrhundert n.Chr. und benutzte ihn als Winterresidenz. Dieser „Fürst der Gläubigen“ wie er sich auf einem Marmorstein nennt, stand dem Prunk des Herodes nicht nach. Quadratische Höfe, Brunnen, Zisternen, die wahrscheinlich schönsten Bäder dieser Zeit und zwei Moscheen zeugen (wenn auch nur noch als Ruinen) davon.
Nach diesem prall gefüllten Tag ging es dann im Dunkeln nach Jerusalem zurück. Am Checkpoint beließ es das Militär bei einem strengen Blick auf uns müde Touristen, bevor es uns durch ließ und der nette Busfahrer brachte Jean-Pierre und mich, die wir als letzte und verspätet am Morgen zugestiegen als erste zu unserer Herberge auf dem Ölberg.
Ein anstrengender, aber doch sehr schöner Tag ging zu Ende. Viele Grüße Joachim
E-Mail vom 13.11.2012
Liebe Freunde,
hier meinen Bericht über unseren Ausflug nach Galiläa.
Ein zweites Mal unternahmen wir einen Ausflug mit dem Kleinbus des Hotels Jerusalem. Dieses Mal erreichte uns die Nachricht von Rania zeitig und pünktlich fanden wir uns an der Abfahrtsstelle in der Nähe des Damaskustores ein.
Gemeinsam mit fünf weiteren Ausflüglern ging es pünktlich los. Der Busfahrer war der gleiche. Im Gegensatz zum letzten Mal, wo er sich tagsüber wegen Fastens Ess- und Trinkverbot auferlegt hatte, wirkte er fröhlich und mitteilsam.
Es ging wieder im zügigen Tempo hinab ins Jordantal. Dort angekommen bogen wir in nördlicher Richtung ab. Wir folgten auf einer Länge von 80 km dem Jordan durch die West- Bank nach Norden Richtung See Genezareth.
Gerne hätte ich mal den Jordan gesehen. Fehlanzeige. Wieder war der Uferbereich weiträumig mit Draht einschließlich Stacheldrahtaufsatz versperrt. Ein breites Gebiet westlich des Jordanufers, also auf Palästinensergebiet, ist militärisches Sperrgebiet oder steht unter militärischer Überwachung und die Israelis haben hier das ausschließliche Sagen.
An einer Kreuzung zweigt eine Straße rechts in östliche Richtung ab. Sie führt zur Allenbybrücke nach Jordanien hinüber und weiter Richtung Amman.
Der Grenzübertritt ist an dieser Stelle nur Diplomaten, Ausländern und Palästinensern gestattet. Außer Eliat ganz im Süden (nicht für Palästinenser) und einem Übergang nur für Israels südlich des Sees von Genezareth, ist es der einzige Übergang ins Nachbarland. Außerdem verläuft der gesamte Warenverkehr aus dem Westjordanland nach Jordanien ausschließlich über diese Brücke. Da Palästinenser nur sehr selten eine Ausreisegenehmigung über den Flughafen TelAviv erhalten, müssen sie über die Brücke um von Amman abzufliegen, wenn sie ins Ausland wollen. Die Grenzkontrollen sind penibel, ja schikanös, sodass stundenlange Wartezeiten in großer Hitze vorprogrammiert sind. Rudolf Rogg, der auch für Jordanien zuständig ist, erzählte, dass er letztens dreieinhalb Stunden brauchte, obwohl er mit Diplomatenkennzeichen unterwegs war.
(Wer mehr über die Allenbybrücke erfahren möchte: http://de.wikipedia.org/wiki/Allenby-Br%C3%BCcke )
Wir fuhren also in Richtung Norden. Auf jordanischer Seite ist das Jordanufer ein Garten Eden. Plantage reiht sich an Plantage. Fehlanzeige auf unserer Seite. Vertrocknetes Gras und Sicherheitszaun sowie Wege für die Militärfahrzeuge säumen den Weg. Nur gelegentlich sieht man, in gebührender Entfernung zum Jordan Plantagen oder ein jüdisches Siedlerdorf (Settlemans) mit von Militärs bewachter und Schlagbaum versehener Zufahrt. Es ist eine Sünde und Schande, dass man wegen der vertrackten politischen Situation und israelischen Sicherheitsinteressen dieses Ufer des Jordans landwirtschaftlich so wenig nutzen kann.
Wir verlassen die Westbank und erreichen südlich des Sees von Genezareth Galiläa und damit den Norden Israels.
Bis nach Nazareth, unserem ersten Etappenziel sind es noch 43 km. Die Stadt liegt auf der Höhe und ist schon von weitem sichtbar. Meine Vorstellung, die ich aus den Bibelstunden meiner Kindheit mitgenommen habe: Ein kleiner Ort, in dem Jesus seine Kindheit und Jugend verbrachte und in einem kleinen Anwesen seiner Eltern Maria und Josef nebst angegliederter Schreinerei wohnend.
Schon von weitem löst sich diese idyllische Vorstellung in Luft auf. Nazareth heute ist eine moderne Stadt mit 60% arabischer und 30% christlicher Bevölkerung, die friedlich zusammenleben.
Ähnlich wie Jean-Pierre und mich zieht es viele Touristen hierher. Alle strömen zur Verkündigungskirche im Stadtzentrum, ein Muss für beinahe alle katholischen und orthodoxen Pilger. Glaubt man doch, dass an diesem Ort in einer Grotte Maria lebte und ihr dort der Engel Gabriel erschien. Näheres kann man bei Lukas 1/26-38 nachlesen.
Unser Busfahrer entließ uns, nachdem er nur mit Mühe einen Haltepunkt gefunden hatte, für eine Stunde. Eine mit Andenkenläden vollgestopfte Straße führt etwas hinauf zu einer riesigen Basilika mit angeschlossenem Franziskanerkloster. Wir waren das Schlange stehen mittlerweile gewohnt. Dennoch ging es recht zügig hinein. Das große Innere hat zwei Ebenen, eine Äußere und eine Innere, in die man auf einer Treppe zur Verkündigungsgrotte hinabsteigt. Da das Gedrängel sich in Grenzen hielt, bemerkte ich viele Gläubige, die kniend davor verweilten.
Auf der äußeren Ebene sah ich eine Gruppe farbiger Pilger, die trotz des Ansturms ein Eckchen gefunden, einen Kreis gebildet, sich an den Händen haltend mit geschlossenen Augen beteten, sangen, meditierten. So viel tiefe Frömmigkeit bewegte mich.
Auch an solch einem wichtigen Ort der Christenheit befielen Jean-Pierre und mich banale Hungergefühle; denn es war Mittag und wir hatten seit früh morgens nichts mehr gegessen. Am Kreisverkehr, nahe der Altstadt, fanden wir ein Kebab-Resto, das auch Dosenbier hatte. Nach dem Verspeisen eines mit Fleisch und Gemüse lecker gefüllten Fladenbrotes und /spandem Gerstensaft ging es uns richtig gut.
Zu einem Mittagsschläfchen im Bus war der Weg nach Kanaa (8,4 km) zu kurz. Ähnlich wie Nazareth ist Kanaa heute eine moderne Stadt. Inmitten liegt die Hochzeitskirche, in der Christus anlässlich einer Trauung und wegen einer Fehlkalkulation bei der Ver-sorgung der Gäste mit Wein sein erstes Wunder vollbrachte und dafür sorgte, dass im Gegensatz zum ausgegangenen billigen Wein ein edler Tropfen in ausreichender Menge die Hochzeitsgäste erfreute.
Wegen des Touristen- bzw. Pilgeransturms ist die Hochzeitskirche nebst Vorplatz nur durch eine Gittertür erreichbar, die meist verschlossen und hin- und wieder geöffnet wird. Meine Mitreisenden hatten einen Moment der offenen Tür erwischt. Mein wallonischer Mitpilger Jean-Pierre und ich haben diese wundersame Türöffnung verpasst. Auch ein Rütteln und mein klagendes Rufen: „Ich will hier rein!“, brachten keinen Erfolg. Ich war ein wenig neidisch; denn ich hätte doch zu gerne, wenn auch nur symbolisch und mit meiner ganzen Vorstellungskraft den köstlichen Rebensaft probiert.
Ganze 23 km trennten uns vom See Genezareth, dem nächsten Ziel unserer Reise. Ehe es mit kräftigem Gefälle hinunter nach Tiberias geht, hat mein einen herrlichen Blick auf den See. Wenn ich ihn auf der Karte sehe, hat er für mich etwa die Form des Erdteils Afrika. Mit einer Wasserfläche von 165 km² ist er nur ein Drittel so groß wie der Bodensee. Als Wasserreservoir ist er für Israel unersetzlich. Nicht nur die gesamte Umgebung, einschließlich der Felder und Platanen profitiert mittels Bewässerungskanäle sondern auch die Wasserversorgung TelAviv’s, ja sogar bis in die Wüste Negev hinein, gewährleistet dieser See.
Darüber hinaus ist er ein beliebter Erholungs- und Ausflugsort der Israelis selbst; denn seit dem Krieg 1967 und der Besetzung der Golanhöhen, die sich an das Ostufer des Sees anschließen, ist der See in rein israelischer Hand. Erwähnenswert ist noch, dass seine Wasseroberfläche 212 m unter dem Meeresspiegel liegt, er somit nach dem Toten Meer das tiefst gelegene Binnengewässer ist.
Wir steuerten Kafarnaum an, wo nach der Bibel die Brotvermehrung stattfand. Eine gleichnamige Kirche, erinnert an dieses Wunder. Sie gehört bis heute dem Deutschen Verein vom Heiligen Land, der das Grundstück 1889 erwarb und Glück hatte; denn anschließende Ausgrabungen brachten die Reste einer Kirche aus dem 4. Jahrhundert, ein Mosaik mit Tier- und Pflanzendarstellung aus dieser Zeit sowie den Felsen zum Vorschein, auf dem Christus das Wunder vollbrachte. Die heutige Kirche wurde erst 1983 eingeweiht. Das Mosaik aus dem 4. Jahrhundert befindet sich im Nord-östlichen Teil der Kirche und ein Brotvermehrungsmosaik aus dem 5. Jahrhundert vor dem Altar. Unter letzterem sieht man den Felsen, auf dem die Brotvermehrung stattgefunden haben soll.

Mosaik aus dem 2. Jahrhundert
Die Benediktinermönche des angrenzenden Klosters (darunter viele Deutsche) kümmern sich um Kirche und Besucher. Zahlreiche freiwillige Helfer (Volontäre) unterstützen sie dabei. Ich stelle mir diese wunderschöne Anlage, begrünt und am See gelegen früh morgens oder abends vor, wenn sie für Touristen gesperrt ist und komme ins Schwärmen
Nur wenige hundert Meter weiter liegt die Stelle, wo Christus nach seiner Auferstehung – gemäß der Bibel und katholischer Interpretation -, den in Kafarnaum wohnenden Fischer Petrus mit seiner Nachfolge auf Erden beauftragte: „Folge mir nach!“ Eine Kapelle erinnert daran und mit etwas Phantasie kann man sich am Ufer stehend gut Petrus vorstellen, wie er sein Fischernetz im See auswarf.
Zwei Kilometer weiter war ich dann auch im See, nicht auf Fischfang sondern als Badender. Diesmal konnte ich mich im Wasser richtig austoben, ohne die Befürchtung, Salzwasser in die Augen zu bekommen. Dazu hätte ich nämlich weiter raus schwimmen und tief tauchen müssen; denn die tieferen Schichten des Sees sind salzhaltig.
Beim Anblick des Jordan war ich zunächst enttäuscht; denn er ist eher ein Bach und nicht gerade sauber. Am Ufer tummelten sich neben den Touristen viele weiß gewandete Männlein und Weiblein, manche davon befanden sich im Wasser. Hier kann man sich – gegen Geld – einer Taufe unterziehen, die durch Untertauchen in Rückenlage vollzogen wird. Nase zuhalten, ist angesagt. Eine Urkunde bezeugt das Ganze. Ich schließe nicht aus, dass manche der jährlich Tausenden, die sich dieser Prozedur unterziehen, dies aus voller religiöser Überzeugung tun. Ich konnte mich aber auch nicht des Eindrucks erwehren, dass dies vor allem ein Spektakel und Gaudium war, was genauestens durch Fotos oder Filmen festgehalten, den Zuhausegebliebenen gezeigt werden sollte. Nun ja, jedem das Seine.
Ich hoffe nur, dass die Sache nicht überhandnimmt und der für die ganze Gegend so lebenswichtige Jordan nicht zu Schaden kommt. Schaden nehmen könnten die Täuflinge selbst; denn hygienisch scheint mir das Ganze nicht, wenn auch offizielle Stellen die Sauberkeit des Wassers beschwören.
Beim Verlassen der Taufstätte war es wieder dunkel geworden. Die Rückfahrt erfolgte im Jordangraben. Die hell erleuchtete jordanische Seite zeigte uns, wie dicht besiedelt diese Gegend dort ist.
Dieses Mal wurden wir nicht zum Ölberg gefahren. Dies war uns auch ganz recht; denn wir hatten wieder Hunger und beschlossen den Tag in unserem arabischen Restaurant, wo wir uns fast als Stammkunden fühlten. Ein rascher Marsch hinauf zum Ölberg trug zur notwendigen Kalorienreduzierung bei.
Viele Grüße
Joachim (Mauer)
E-Mail vom 14.11.2012
Liebe Freunde,
ich habe während meiner Berichterstattung schon mehrmals angedeutet, dass ich mich sehr für die Situation der Palästinenser interessiere.
Einen kompetenten Ansprechpartner habe ich in Rudolf Rogg gefunden, den ich aus meiner Zeit in West-Afrika kenne und der Direktor der „Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)“ – ein Zusammenschluss von GTZ und DED – mit Sitz in Ramallah ist. Rudolf wohnt auf dem Ölberg und fährt täglich rüber in die Hauptstadt des Autonomiegebietes.
An einem Vormittag konnten wir ihn mit seinem PKW dorthin begleiten. Um den Checkpoint in beiden Richtungen passieren zu können, muss man ein israelisches Autokennzeichen besitzen, das – ähnlich unseren Kennzeichen – links auf einem blauen Feld oben die Flagge Israels, in der Mitte das Länderkürzel IL und ganz unten den Landesname in hebräischer und arabischer Schrift trägt. Daneben folgt auf hellbraunem Untergrund eine siebenstellige Nummernfolge. Autos mit diesen Nummernschildern können in Israel und auch in der West-Bank fahren. Für beide Bereiche muss man gesonderte Versicherungen abschließen. Dies bezieht sich auch auf LKW’s, Busse und Taxis. Palästinenser, die in den Autonomiegebieten leben, haben eigene Kennzeichen auf ihren Autos. Mit diesen dürfen sie nicht nach Israel.
Die Autoschlange am Checkpoint wird recht zügig abgefertigt. Kommentar von Rudolf: „Raus aus Israel geht relativ schnell. Wieder reinzufahren, das kann dauern.“
Zunächst fahren wir an dieser schrecklichen Mauer (/verniedlichend Wall genannt) vorbei. Sie ist bunt bemalt und – so vermute ich – mit für Israel wenig freundlichen Sprüchen versehen.
Gleich anschließend der erste Ort. Hier sollte man besser keinen Unfall bauen; denn es ist ungeklärt, wer zuständig ist, die israelische oder palästinensische Polizei. Also versuchen die Unfallgegner die Angelegenheit selbst zu regeln. Verletzt werden sollte man bei einem Unfall nicht. Es kam schon vor, dass Verletzte am Checkpoint hängen blieben, bis irgendwann mal ein israelischer Krankenwagen sie abholte.
Nach 20 km standen wir in Ramallah vor dem „German House“, Rudolf Roggs Büro. Ein ansehnliches Gebäude. Über 100 Mitarbeiter hat die GIZ in Palästina (West-Bank und Gaza) im Einsatz. Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung, nachhaltige Wirtschaftsförderung, Verwaltungsaufbau sowie Förderung von Institutionen und Zivilgesellschaft sind die Schwerpunkte.
Ich habe den Eindruck, dass der von Saulus zum Paulus gewandelte derzeitige Entwicklungsminister Niebel der Zusammenarbeit mit Palästina Priorität einräumt und dies auch durch häufige Präsenz vor Ort sichtbar werden lässt.
Dabei steht das deutsche Engagement im argwöhnischen Blick der Israelis, und man muss schauen, dass man es sich mit ihnen nicht verdirbt; denn letztendlich sind sie es, die mit ihrer dominanten militärischen Präsenz hemmen und verhindern können.
Diese Dominanz hat aus jüdischer Sicht Ursachen, die man nicht so ohne weiteres wegwischen kann. Stichworte: Hohes Sicherheitsbedürfnis herrührend aus zahlreichen Kriegen, Indifada, Attentate mit Verletzung und Tötung Unschuldiger, Raketenbeschüsse usw..
Auf der anderen Seite weiß der jüdische Staat sehr genau, dass der ständig wachsenden palästinensischen Bevölkerung ein Minimum an Entwicklung zugestanden werden muss angesichts der Zumutungen, die sie durch Mauer, Kontrollen, Eingesperrtheit und der ungebremsten Siedlungspolitik (Settlemans) mehr oder weniger machtlos hinnehmen muss. So nach dem Motto: Wenn wir es schon nicht tun wollen, so sollen wenigstens andere durch ihr Engagement Dampf aus dem palästinensischen Kessel nehmen.
Natürlich spielt die Sicherheit und Unversehrtheit der GIZ-Mitarbeiter eine große Rolle. Gepanzerte Autos mit Diplomatenkennzeichen gehören zum Fuhrpark. Eine ehemalige Bundespolizistin hat bei der GIZ die Aufgabe, sich um die Sicherheit der Mitarbeiter zu kümmern. Sie pflegt dazu Kontakte zu beiden Seiten: Mit der palästinensischen Polizei ebenso wie mit den israelischen Militär- und Polizeibehörden.
Wie wichtig dies ist, zeigt ein Beispiel: Im Gazastreifen kommt es zu einem Beschuss und Rudolf Rogg, gerade dort unterwegs, erlebt diesen Angriff in unmittelbarer Nähe. Besorgt um seine Unversehrtheit, telefoniert er mit seiner Sicherheitsbeauftragten und diese wendet sich sofort an das israelische Militär. Dort wird ihr gesagt: „Wir wissen genau, wo sich ihr Chef aufhält. Ihm wird nichts passieren.“ Und so war es auch.
Ehe wir das German-Hause verlassen, lädt uns Rania, Rudolf Rogg’s Mitarbeiterin, zu sich und ihre Familie nach Nablus, dem wirtschaftlichen Zentrum des Westjordanlandes, ein. Gerne nehmen wir diese Einladung an.
Für heute wollen wir uns noch Ramallah anschauen und dann mit dem Bus zurück nach Jerusalem fahren.
Als wir auf die Straße kommen, stehen dort im Abstand von 50 m palästinensische Polizisten. Ich erfahre, dass Präsident Habbas auf seinem Weg von zu Hause in seinen Amtssitz in nächster Zeit vorbei fährt. Die Polizisten sind zugänglich und suchen das Gespräch mit uns: „Wo seid ihr her?“ Unsere Antwort: „Aus Belgien und Deutschland.“ Sie: „Welcome in Palästina!“ Diesen Satz hören wir noch häufig.
Ein kleiner Zwischenfall am Rande. Ich habe meine Mütze vergessen. Rania wirft sie mir aus dem zweiten Stock zu. Die Kopfbedeckung bleibt auf dem Vordach des Eingangs liegen. Ein hilfsbereiter Polizist friemelt sie mit seinem Maschinengewehr herunter. Schusswaffen können auch friedlichen Zwecken dienen, stelle ich befriedigt fest.
Ich war scharf darauf, den palästinensischen Präsidenten zu sehen, der ja im Konvoi vorbeikommen soll. Wir gehen also in Richtung Präsidentenpalast. Als wir dann vor dem Eingang stehen, ohne aufgehalten worden zu sein, treffen wir einen jungen, sichtlich nervösen, nicht uniformierten, mit Anzug, Hemd und Schlips gekleideten Menschen mit
Gel im Haar, der an die herum-stehenden Polizis- ten Befehle erteilt. Ich vermute, es handelt sich um den Sicherheitschef des Präsidenten. Er redet nicht mit uns, sondern lässt über einen Polizisten wissen, dass wir hier verschwinden sollen.
Ganz langsam entfernen wir uns und sehen dann doch den Konvoi kommen: Militärfahrzeug – Mercedes – Mercedes – Mercedes – Militärfahrzeug. In welchem Mercedes Habbas saß, weiß wohl nur unser Sicherheitschef mit seinen fest geklatschten Gelhaaren.
Gleich neben dem Amtssitz befindet sich das Mausoleum von Arafat. Der Sarkophag ist durch ein großes Fenster zu sehen. Das Gebäude konnten wir nicht betreten. Es war abgesperrt. Heute weiß ich warum: Eine Expertenkommission ist damit beschäftigt, den Sarg zu öffnen und die Reste Arafats zu untersuchen; denn man vermutet nach wie vor, dass er vergiftet wurde.
Wir gehen durch die Stadt. Ich habe den Eindruck, wir sind die einzigen Touristen. Der Busbahnhof ist voller Busse und Menschen. Kein Wunder. Öffentliche Kleinbusse mit israelischer Nummer kommen vom Damaskustor in Jerusalem bis hierher. Für sie ist hier Endstation. Die Passagiere steigen in Busse mit palästinensischem Kennzeichen, um in andere Orte und Städte des Westjordanlandes zu gelangen.
Wir steigen in einen Bus mit Israelnummer. Es dauert nicht lange, bis er gefüllt ist, und wir fahren zum Checkpoint. Hinüber kommen nur Passagiere, die wie wir ausländische Touristen sind (ziemlich wenige) oder Palästinenser mit israelischem Ausweis, oder Palästinenser mit Genehmigung, da in Israel arbeitend oder mit Sondergenehmigung, die nur schwer zu bekommen ist. Anträge müssen gestellt werden, werden oft ohne Begründung abgelehnt oder werden verspätet genehmigt, also dann, wenn der Besuchsanlass verstrichen ist. Ehe wir zum Checkpoint kommen, dreht sich ein älterer Herr, der vor mir sitzt, um und stellt in perfektem Deutsch die üblichen Fragen: Woher seid ihr? Was macht ihr hier? usw. Er erzählt mir, dass er Fremdenführer ist und deutsche sowie englische Gruppen führt. Er gibt mir seine Visitenkarte: Abdullah Tuffaha, Tourist Guide, English – Geman, The Holy Land, Jerusalem. Adresse, Telefon.
Der nette Herr Tuffaha steht uns mit Rat und Tat zur Seite, als wir am Checkpoint ankommen. Wir wollen den Aussteigenden folgen. „Stopp!“, sagt Herr Tuffaha, „Ihr seid über 45 und könnt im Bus bleiben. Nur Leute unter 45 müssen durchs Checkpointgebäude und sich dort strenger Kontrolle unterziehen; Selbstmordattentäter waren bisher immer Jüngere. Wir Ältere sind weniger verdächtig und dürfen im Bus bleiben.”
Zwei junge Militärs kommen in den Bus. Der Männliche bleibt vorne mit gezücktem Maschinengewehr stehen, eine Soldatin prüft die Papiere. Das Auftreten der Beiden empfinde ich als bedrohlich. Ihr Ton ist befehlend und schneidend. Die sind darauf gedrillt weder Höflichkeit noch menschliche Gefühle zu zeigen. Die Passagiere bewahren eine stoische Ruhe. Ich denke: „Muss das sein, dass man so mit Menschen umgeht, die ihre Eltern oder Großeltern sein könnten?“ Ich bin fassungslos und empfinde die gleiche Ohnmacht, wie ich sie bei manch einer DDR Kontrolle in früheren Zeiten empfunden habe. Nachdem die beiden uns grußlos verlassen haben, öffnet sich der Schlagbaum. Wir fahren durch zu einem Parkplatz. Langsam trudeln die anderen ein, die den Bus verlassen mussten. Ich stelle fest: Einer fehlt. Den haben die bestimmt zurückgeschickt.
Auf dem Weg zum Damaskustor gibt uns Herr Tuffaha noch wertvolle Tipps: „Ihr müsst mal auf die Stadtmauer steigen. Man kann auf ihr entlanspan style=”color: #454545;”g gehen. Man hat von dort oben einen tollen Blick auf Teile der Altstadt und die Umgebung.“ Ich bin der Empfehlung des Herrn Tuffaha gefolgt. Es hat sich gelohnt. Danke, Herr Tuffaha!
Viele Grüße Joachim (Mauer)
E-Mail vom 14.11.2012
Liebe Freunde,
wie ich schon schrieb, haben wir gerne die Einladung von Rania nach Nablus angenommen. Unser Kommen fiel in das viertägige Opferfest (Eid ad-Adha), dem höchsten Fest des Islams, vergleichbar bei uns mit Weihnachten.
Den Weg mit dem Bus nach Ramallah kannten wir schon. Wir stiegen dort in einen solchen mit palästinensischer Nummer und fuhren weiter Richtung Nordosten ins 50 km entfernte Nablus. Ich wunderte mich, dass wir oft auf Nebenstrecken fuhren, obwohl es doch eine gut ausgebaute Direktverbindung gab. Aber diese Straße ist nicht durchgängig für KFZ mit palästinensischen Kennzeichen befahrbar. Dazu braucht man wieder eine von den Israelis erteilte Sondergenehmigung. Rania hat so eine, da sie bei der GIZ arbeitet und spart dadurch für ihrer tägliche Fahrt nach Ramallah viel Zeit.
Wir quetschten uns also durch schmale Straßen und Ortsdurchfahrten. Für uns hatte das den Vorteil, dass die Landschaft nicht so schnell an uns vorbeisauste. Der Norden des Westjordanlandes ist ebenso wie das sich anschließende israelische Galiläa altes Kulturland. Obwohl gebirgig, steinig und von längeren Trockenperioden geprägt, jedoch von mediterranem Klima begünstigt, pflanzt man seit hunderten von Jahren Oliven, Zitrusfrüchte, Obst, Trauben, Gemüse, Kräuter und Weizen an. Wir beobachten im Vorbeifahren viele Bauern beim Pflücken von Oliven. Mühsame Handarbeit. Da wir Ende Oktober haben, sind die Felder abgeerntet.
Häufig sehen wir auf den Höhen Häuser der jüdischen Siedler (Settlemans). Manchmal sind es nur Wohncontainer, vielfach aber auch schmucke Häuser neueren Datums.
Bei meinen Gesprächen mit Leuten vor Ort erfahre ich, dass die derzeitige israelische Politik unter Netanjahu, der in seiner Regierung Vertreter der Siedler sitzen hat, die ihm seine Parlamentsmehrheit sichern, diese Landnahme wieder offensiver betreibt und die Leute durch Fördergelder hierher lockt. Mir liegen nur ältere Zahlen vor: 1966 gab es im West-Jordanland 0 Siedler, 1993 schon 110.000 und 2009 bereits 300.000.
Man muss sich die West Bank wie einen Schweizer Käse vorstellen. Die Löcher sind die israelischen Siedlungen und diese Löcher werden immer größer. Wertvolles Ackerland geht den Palästinensern verloren. Ohne Entschädigung, es wird einfach weggenommen. Oft wehren sie sich mit Prozessen, die sich meist lange hinziehen und – selbst wenn sie Recht bekommen – nichts ändern. Das schafft Verzweiflung und Aggression. Nur mit Einzäumung der Siedlungen, eigener Zufahrten mit Barrieren, Wachhäuschen, Militär (das sich das Gelände für Lager und Technik ebenso entschädigungslos nimmt) können Auseinandersetzungen größeren Ausmaßes unterdrückt werden.
Palästinensische Dörfer, Felder, Olivenhaine, Siedlungen, Militärpräsenz, all das sehe ich und mache mir darüber Gedanken.
So kommen wir in der Großstadt Nablus (250.000 Einwohner) an und Rania holt uns am Busbahnhof ab. Wir fahren zu ihr. Gemeinsam mit ihrem Mann Radwan und den beiden Kindern bewohnen sie ein schönes Eigenheim am Rand der Stadt, die von Bergen umgeben ist. Man hat einen tollen Ausblick, hier auf halber Höhe, hinab auf das Häusermeer und hinüber zur neuen An-Najah Universität mit ihren 20.000 Studenten und knapp 900 Professoren. Radwan ist einer von ihnen und lehrt Physik.
Die Einliegerwohnung war für Jean-Pierre und mich hergerichtet und ein tolles palästinensisches Mittagessen erwartete uns. An Gesprächsstoff fehlte es nicht. Wir erzählten von unseren Familien und unserem Hobby, dem Wandern. Radwan von seinem Studium in Deutschland, seiner Promotion in Palästina und seiner Uni-Arbeit. Die Familienarbeiten werden geteilt. In der Woche kümmert er sich tagsüber um die Kinder, da Rania einschließlich der Fahrt nach Ramallah zehn Stunden außer Haus ist.
Heute am dritten Tag des Opferfestes trifft sich die Familie bei Radwans Mutter in einem östlich gelegenen Städtchen und wir dürfen mitkommen. Am Ausgang von Nablus stelle ich fest, warum deutsche Entwicklungszusammenarbeit auch die Müllentsorgung einbezieht; denn wild abgelagerte Müllberge schmoren vor sich hin und verpesten die Luft. Den deutschen Experten habe ich übrigens kennengelernt, er heißt mit Nachname Wunder. Er wird wohl keine Wunder vollbringen können; doch ich wünsche ihm und den palästinensischen Stellen, dass man bezüglich der Müllentsorgung rasch vorankommt.
Herzlich werden wir von Radwans Familie begrüßt: Mutter, Brüder, Schwestern, Schwager und deren Kinder. Die Großfamilie ist intakt. Die Männer kümmern sich um uns in der guten Stube bei Tee, leckerem Kuchen und Früchten. Gesprächsthemen wie überall auf der Welt: An erster Stelle die Familie und jeder stellt seine Kinder vor. Ich habe auf meinen Reisen immer Fotos von meiner Familie und dem Häuschen in der Eifel mit, die ich stolz zeige. Ein Bruder von Radwan hielt sich gerade in Mekka auf. Er bereitet Glaubensgenossen auf die Hadsch (die Pilgerfahrt) vor und begleitet sie dorthin.
Ein Schwager sprach (ebenso wie Radwan und Rania) perfekt Deutsch. Er hat zehn Jahre in Ulm gelebt und dort als Ingenieur gearbeitet. Mit ihm- wie auch mit anderen – sprach ich auch über die palästinensische Innenpolitik.
Gerade hatten Kommunalwahlen stattgefunden. Die Fatah, Partei des Präsidenten Abbas, hat dabei massiv verloren und viele Unabhängige wurden als Bürgermeister und Gemeinderäte gewählt. Hamas, die im Gazastreifen das Sagen hat, war zur Wahl nicht zugelassen.
Ich gewinne den Eindruck, dass die Unzufriedenheit der Leute hier sehr groß ist. Dies hat einerseits mit der israelischen Besatzung zu tun, aber auch mit der tiefen Zerstrittenheit der Palästinensischen Machthaber vertreten durch die gemäßigte Fatah im Westjordanland und die radikale Hamas im Gazastreifen. Beide können in den Augen der Leute fast keine Erfolge vorweisen. Man hat den Eindruck, die Lage wird immer schlimmer; zumal die israelische Politik diese Schwäche für sich nutzt. Die amerikanische Politik, die wohl am ehesten eingreifen könnte, war mit Wahlkampf und Innenpolitik mit sich selbst beschäftigt und die Weltöffentlichkeit ist den Konflikt mehr oder weniger leid und wendet sich anderen Schauplätzen wie zuletzt Syrien zu. Die Palästinenser fühlen sich mit ihren „big problems“ allein gelassen.
Immer wieder höre ich: „Wir möchten normal leben können! Wir können uns ein Zusammenleben mit den Israelis vorstellen, wenn es auf Augenhöhe geschieht! Wir müssen uns ja nicht lieben.“ Doch die Extremen auf beiden Seiten – habe ich den Eindruck – werden dies noch lange verhindern. Ich bin ziemlich deprimiert.
Am Abend machen wir noch eine Stadtrundfahrt durch Nablus. Wegen des Opferfestes sind die Gaststätten voll. Den Park in Nähe des Zentrums mit Spielplatz, die nahezu einzige größere Grünanlage der Stadt, bevölkern viele Familien.
Am nächsten Morgen – nach einem tollen Frühstück – wollen wir noch zu einem der beiden Flüchtlingslager, dem Bazar und einer Seifenfabrik. Gut, dass uns Rania begleitet. Sie sorgt dafür, dass wir überall hin- und auch fotografieren können.
Zunächst fuhren wir zu einem der beiden Flüchtlingscamps. Es befindet sich nicht etwa in einer Zeltstadt, sondern inmitten der Stadt innerhalb eines Wohngebietes. Seit 1948 besteht es und die Enge der ineinander geschachtelten Häuser und schmalen Gassen ist spürbar. 16.000 Menschen hausen da. Großeltern, Eltern, Kinder, Enkel, Urenkel auf engstem Raum. Wir gehen durch die Gässchen und – da Feiertag – begegnen uns viele Kinder. Die Jungen spielen ausschließlich und begeistert mit ihren Plastik-Maschinengewehren.
An den Hauswänden bemerken wir viele Bilder von und Texte über „Märtyrer/n“, also Leuten, die bei der 2.Indifada oder später getötet wurden. Andere Plakate zeigen Palästinenser, die in israelischen Gefängnissen einsitzen.
Das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina (UNRWA) kümmert sich seit 1950 um die Flüchtlinge. Es gibt eine eigene Schule, die alle schulpflichtigen Kinder besuchen. Ranias Vater arbeitete lange Jahre im Auftrag der UNRWA als Arzt in diesem Flüchtlingslager.
Nur wenigen Flüchtlinge finden Arbeit und können sich eine neue Existenz außerhalb des Lagers aufbauen.
Der Basar von Nablus ist eine Wucht.
Gleich zu Beginn werden Hunderte von Wasserpfeifen angeboten.

 Ansonsten all das, was man so in einem Basar einkaufen kann, in Überfülle. Überall können wir fotografieren. Die Leute begegnen uns freundlich. Immer wieder: „Welcome in Palästina.“
Ansonsten all das, was man so in einem Basar einkaufen kann, in Überfülle. Überall können wir fotografieren. Die Leute begegnen uns freundlich. Immer wieder: „Welcome in Palästina.“
Nablus behauptet von sich die Seife erfunden zu haben und das vor langer Zeit. Es gab mal fast 20 Seifenfabriken. Basisprodukt für die Seife ist das Olivenöl. Da die Olivenproduktion stark zurückging, insbesondere auch dadurch, dass Siedler und Militärs Olivenhaine beschlagnahmen und die Bäume abholzen, ist auch die Zahl der Seifenfabriken stark zurückgegangen. Eine konnten wir besichtigen. Der Besitzer zeigt uns die Fabrik und erklärt die Herstellung. Teilweise muss das Olivenöl importiert werden. Zum Abschluss und als Andenken bekommen wir eine Warenprobe mit.
Es ist mittlerweile Mittag. Wir packen unsere Rucksäcke. Der Abschied von Rania, Radwan und den Kindern ist herzlich:“ Wir kamen als Fremde und gehen als Freunde“, darüber sind wir uns alle einig. Ich lade sie zu uns in die Eifel ein. Vielleicht klappt’s mal.
Am Busbahnhof steigen wir in einen Bus, der uns nach Jenin fährt. Ein weiterer wird uns dann zum Checkpoint Al-Jamalah im Norden des Westjordanlandes bringen.
Darüber werde ich als nächstes berichten.
Und nun das: Gerade sehe ich im Fernsehen: Raketen auf TelAviv, Beschuss in den Gazastreifen hinein. Kriegsgefahr. Scheiße.
Viele Grüße
Joachim (Mauer)
E-Mail vom 16.11.2012
Liebe Freunde,
ich bin seit acht Tagen wieder zu Hause in Mehren.
Den aufflammenden Krieg bekomme ich also nicht vor Ort mit. Was da jetzt passiert, ist unglaublich. Ich bin äußerst pessimistisch.
Meine Berichterstattung über meine Erlebnisse werde ich fortsetzen. Allerdings erst in einigen Tagen.
Trotz allem schönes WE.
Viele Grüße
Joachim (Mauer)
E-Mail vom 20.11.2012
Liebe Freunde,
nachfolgend setze ich meinen Bericht fort. Es geht um meine Reise durch den Norden des West-Jordanlandes und das Passieren des Checkpoints bei Jamale (Al Jamalah).
Wir wollten also mit öffentlichen Verkehrsmitteln von Nablus (Westjordanland) in Richtung Norden nach Nazareth (Galiläa) fahren.
Wir waren informiert, dass der Norden der Westbank mit den Städten Nablus und Jenin sich immer wieder gegen die israelische Besatzung aufgelehnt hat. Arafat hatte zu seiner Zeit von Nablus aus den Widerstand organisiert. Das Flüchtlingscamp Dschenin bei Jenin galt lange als Hochburg der Al-Aqsa-Intifada und wird für eine Reihe von Terroranschläge während der 2. Intifada (ab September 2000) verantwortlich gemacht. 2002 ist die israelische Armee in das Lager einmarschiert und hat es teilweise zerstört. Als Folge dieser Ereignisse wurden in diesem Raum zahlreiche Checkpoints errichtet und an der Grenze nach Galiläa, jedoch auf palästinensischem Gebiet, der Grenzwall gebaut.
Wir fuhren also mit dem Bus nach Jenin. Luftlinie liegt die Entfernung bei 20 km. Doch muss sich der Bus wieder über Nebenstrecken quälen, so dass es fast 40 km sind. Das Gebiet ist ebenso landwirtschaftlich geprägt wie zuvor der Süden von Nablus.
Vor der Stadt gab es einen Checkpoint, den wir ohne große Kontrollen passieren konnten.
Jenin hat heute etwa 40.000 Einwohner. Als wir am Busbahnhof aussteigen, erleben wir eine umtriebige Stadt. Wir müssen den Busbahnhof wechseln und gehen etwa 800 m durch die Innenstadt. Wir fragen uns durch und bekommen bereitwillig Antwort. Einen älteren Herrn, der an der Straße sitzt, bitten wir um Auskunft. Er spricht nur arabisch, eilt aber kurz entschlossen ins nächste Geschäft und kommt mit dem Besitzer heraus, der uns weiterhilft.
Als wir im richtigen Bus sitzen, müssen wir etwas warten, bis er voll ist. So können wir etwas das Geschehen um uns herum beobachten. Gleich gegenüber gibt es in einem Bretterverschlag ein kleines Restaurant. Die Tür und das Fenster sind weit geöffnet. Davor sitzt ein übergewichtiger Mann und futtert ein Fladenbrot in sich hinein. Aufgrund seines Verhaltens vermute ich, dass er geistig behindert ist. Als er fertig gegessen hat, klopft er an den Fensterladen und bittet um ein weiteres Brot. Er bekommt es kostenlos. Als er um ein erneutes bittet, schimpft der Wirt und knallt Fensterladen sowie Tür zu. Unser Vielfraß stört sich daran nicht und klopft erneut. Es tut sich einige Zeit nichts und dann kommt der Wirt verschmitzt lächelnd mit drei Fladenbroten heraus und gibt sie ihm. Wir freuen uns mit den Umstehenden über die überraschende Wendung des Geschehens und wünschen dem Unersättlichen, dass er irgendwann satt wird.
Nach einer knappen halben Stunde geht es weiter. Wir fahren zum Checkpoint bei Jalame, der etwa 8 km entfernt ist. Wir müssen da hindurch, um ins israelische Galiläa zu kommen. Unsere Mitreisenden steigen im letzten Dorf vor der Demarkationslinie aus. Der Busfahrer setzte uns auf einem Parkplatz vor dem Checkpoint ab. Er darf hier nicht weiter fahren.
Eine lange Autoschlange wartete auf Abfertigung. Optimistisch dachte ich, dass man uns mit EU-europäischen Pässe auch dort abfertigen würde. Doch der Busfahrer zeigte uns, wo wir als fußläufige Grenzgänger hin müssen. Wir gelangen zu einem Gittergang. Vergleichbar etwa mit einem Durchlass, durch den die Löwen bei einer Vorstellung im Zirkus von draußen in die Manege gelangen. Wir gehen da also hinein und werden von einer großen eisernen Drehtür gestoppt. Die ließ sich nämlich nicht drehen. Dahinter setzte sich der Käfiggang in Richtung eines Gebäudes fort. Kameras waren auf uns am Eingang gerichtet. Es gab keinerlei Hinweise. An der Seite hing ein schwarzer Klingelkasten. Wir haben uns zunächst nicht getraut, auf den Knopf zu drücken. Das taten aber die drei Kinder einer palästinensischen Familie, die mit uns wartete. Die Sprechanlage blieb stumm. Hin und wieder kamen Leute aus der Gegenrichtung und verließen den Käfig durch eine weitere Drehtür, die in Richtung Palästina nicht blockiert war.
Neidisch blickten wir auf die Autoschlange. Da wurde nämlich abgefertigt. Ich dachte daran, einen km auf der Straße zurückzulaufen, um dort zu fragen, ob man uns nicht mit dem Auto mitnimmt. Ich habe es gelassen, weil ich nicht daran glaubte, dass das klappt. Außerdem war meine Neugier geweckt, wie das mit uns Fußgängern weitergeht.
Meine Geduld wurde auf eine harte Probe gestellt. Immer wieder klingelten wir, rüttelten an dem Eisengittertor. Es tat sich nichts. Eine Stunde ging das so. Dann tat sich doch was.
Viele Leute, die draußen auf dem Parkplatz saßen, schlossen sich uns an. Irgendwie mussten die eine Information haben, die wir nicht hatten. Die Frau der Familie, die mit uns im Käfig ausgeharrt hatte, rüttelte an der Drehtür und siehe da, sie drehte sich in der richtigen Richtung. Die Frau ging hinein, und wollte hindurch. Erneute Blockade. Sie war jetzt eingesperrt, Der Auslass nach hinten war ebenso blockiert, wie der nach vorne. Die Frau wird panisch und schreit. Nach einigen Minuten kommt die Erlösung. Das Gitterportal dreht sich wieder.
Für mich und Jean-Pierre wurde es mit Rucksack eng. Im Gittergang ging es weiter in Richtung Gebäude, und durch eine Tür ohne Klinken gelangen wir gemeinsam – unsere Pässe deutlich hoch haltend – mit einem betagten Palästinenser hinein.
In dem Raum befanden sich – mal wieder – die Sprengstoffschnüffelmaschine und daneben der Piepsrahmen. Der ältere Herr deutete auf das Laufband der Sprengstoffschnüffelmaschine und gab uns zu verstehen, unsere Rucksäcke darauf zu legen und auch den Inhalt unsere Hosen- und Jackentasche. Ich tat dies. Wie von Geisterhand setzte sich die Maschine in Gang und das Zeug verschwand im Tunnel. Plötzlich befahl eine schrille und unfreundliche Lautsprecherstimme. „Gehen Sie da durch!“ Als ich nicht gleich dem Befehl nachkomme, raunzt die Stimme mich an. „Verstehen Sie kein Englisch?“ „ Nicht viel. Ich spreche Deutsch und Französisch, “ rief ich mutig in den Raum hinein.
„Go!“ lautete die nächste Aufforderung. Ich ging durch den Piepsrahmen. Er blieb ruhig. Jean Pierre folgte mir. „Piiiip!“ schrie der Rahmen. „Zurück!“ die Geisterstimme. Endlich erkannte ich, wo die Stimme herkam. Hinter einer Kabine mit dicken Scheiben erblickte ich die Konturen zweier Personen mit Maschinengewehren.
Mein Mitpilger durchwühlt seine Hosentaschen nochmals auf Inhalt und ging erneut durch den Rahmen. Piep! „Zurück!“ Piep! „Zurück!“ Piep! „Zurück!“ Da hatte Jean-Pierre die rettende Idee. Er zieht seinen Gürtel aus und legt ihn auf das Band der Sprengstoffschnüffelmaschine. Der Pieprahmen blieb still. Es war wohl die Metallschnalle des Gürtels, die anschlug. Ich hatte auch eine solche am Gürtel; bei mir blieb es still.
„Weiter!“ klang es über den Lautsprecher und irgendwie sah ich am Gestikulieren einer der beiden Schattenfiguren hinter dem dicken Glas, dass man mich meinte. Ich ging durch eine weitere Tür ohne Klinken, die sofort hinter mir zufiel. Ich befand mich in einem zwei Mal zwei Meter großen Raum. Die Wände waren schmucklos. Ich wollte durch die nächste Tür. Da sie ohne Klinke war, drückte ich dagegen. Verschlossen! Ich war eingesperrt.
Nach einigen Minuten kam Jean-Pierre hinzu. Nun summte die klinkenlose Ausgangstür, und ich drückte dagegen. Sie ließ sich öffnen. Wir waren in dem nächsten 4m² Raum. Wumm! Die Eingangstür schlug zu. Wir drücken erfolglos gegen die Ausgangstür, die sich zunächst nicht öffnen ließ. Erneut waren wir gefangen. Endlich das erlösende Summen und wir eilten hinaus, um in den nächsten Verschlag zu kommen. Warten. Summen.
Endlich sahen wir im nächsten Raum rechts eine Militärin in einem Kabuff mit Glasscheibe und Durchreiche sitzen. „Passport!“ fordert die Mitzwanzigerin. Wir schoben unsere Dokumente hindurch. Heftig wurde ein Vorhang zugezogen. Die Frau hinter der Scheibe und unsere Pässe waren verschwunden. Geduld war angesagt. Ich schaute nach oben und sah eine Empore, die als Gang wohl durch das ganze Gebäude führte. Auf dieser Empore stand ein Soldat mit einem Gewehr, das auf uns zeigte, den Finger am Abzug. Dass jemand eine Maschinenpistole auf mich hielt, das hatte ich noch nicht erlebt.
Nach einiger Zeit wurde der Vorhang schwungvoll geöffnet und anschließend schlitterten unsere Pässe ebenso schwungvoll durch die Durchreiche. „Weiter!“. Das war’s wohl, dachte ich und fühlte mich erlöst. Von wegen! Wir gelangten erneut in einen 4m²Verschlag. Der Soldat auf der Empore mit dem Gewehr im Anschlag war uns gefolgt.
Endlich öffnete sich die Tür und wir kamen in eine Halle. Durch die Mitte gehen zwei mit Geländer abgetrennte knapp ein Meter breite Gänge. Wir gelangten in den ersten, der Gegenverkehr im zweiten verschwand durch einen Flur nebenan. Er ist für die Leute, die ins Westjordanland zurückwollen. Die zwei Gänge führen zu einer Kabine mit Glasscheibe und genau dort ist das Geländer dazwischen einen Meter breit geöffnet. Das bedeutet, Passagiere aus beiden Richtungen kommend werden an dieser Knubbelstelle kontrolliert. Die beiden Gänge mit Geländer enden nach 2 Metern und münden in einen größeren Flur.
Eine Soldatin sitzt in der Kabine. Sie ist hübsch, aber unhöflich und herrisch. Oben auf der Empore steht ein Mann in Zivil und sein Maschinengewehr mit Finger am Anschlag zeigt auf uns.
„Passport!“ ertönt die schrille Stimme der hübschen Soldatin. Wir schieben den Ausweis hindurch. Sie blätterte darin und fängt an zu telefonieren. Danach legt sie unsere Dokumente zur Seite. „Warten!“ lässt sie uns wissen und sie deutet in den zweiten Gang. Mittlerweile staute sich der Verkehr, und wir waren mit unseren dicken Rucksäcken mittendrin. Allerdings wurde nicht gedrängelt. Es bildete sich eine Art Solidarität unter den Gebeutelten. Man rückte enger zusammen und wir konnten uns so durch den Durchlass in den Gang für Rückkehrer quetschen und uns in eine Ecke zwängen.
Von dort aus konnte ich gut beobachten, wie die Hübsche mit den Leuen umsprang. Befehlend, schnippisch, genervt prüfte sie Pässe und Passierscheine. Ein Fingerabdruckgerät steht vor der Glasscheibe. Jeder muss einen bestimmten Finger drauf legen. Oft funktionierte das Gerät nicht, da die Fingerrillen voll Schweiß waren. Befehl. Ich sah, wie der Klient ein Taschentuch herauskramte und kräftig auf der Fingerkappe rieb. Befehl. Erneuter Versuch. Erfolglos. Befehl. Ein anderer Finger kommt zum Einsatz. Es klappt. Er darf hindurch.
Bei einem Anderen sind anscheinend die Papiere nicht in Ordnung. Es wird telefoniert. „Zurück!“ Alles bitten und argumentieren half nichts. Die Hübsche ist unerbittlich. Betröpfelt und fast weinend geht der Betroffene wieder in Richtung West Bank.
Das Telefon klingelte. Mein Pass wurde geöffnet. An den Lippen der unerbittlichen Kontrolleurin erkenne ich, dass sie wohl meine Passnummer durchgibt. Sie stockte öfters und schaute genauer hin. Ich habe eine Vermutung. Mein Pass ist neueren Datums und die Nummer besteht aus einer Kombination von Buchstaben und Ziffern. Das Hebräische gebraucht wohl die gleichen Ziffern, kennt aber nicht unsere Buchstaben. Und dann hat meine Passnummer auch noch zweimal das seltene Y. Doch irgendwie schafft es die Schöne und durch das Telefon scheint grünes Licht zu kommen. Sie winkt uns an die Kabine, reicht die Pässe durch und lässt uns in die richtige Richtung ziehen. Noch ein Flur und wir sind draußen. Geschafft! Wir waren wohl doch keine Hamas oder Fatah Söldner. Knapp eine Stunde hat es gedauert um festzustellen, dass wir beiden Rucksackträger älteren Semesters nur harmlose Reisende waren.
Dabei mussten wir noch zufrieden sein. Bei uns agierte man mit gebremstem Schaum. Gegenüber den Palästinensern gab man sich befehlend, herrisch, von oben herab, ja fast brutal. So was muss antrainiert sein. Die gute Kinderstube müssen die wohl während des Dienstes ablegen.
Im Nachhinein habe ich so manches von den Kontrollen verstanden:
Bei der Gepäckkontrolle zu Beginn waren die Soldaten hinter schusssicheren Scheiben. Es könnte sich ja um einen Selbstmordattentäter handeln, der sich in die Luft bombt.
In den anschließenden Kabinen können Leute festgesetzt und befragt werden, bei denen Verdacht besteht.
Bei der ersten Passkontrolle werden die Pass- und Passagierscheindaten in den Zentralcomputer eingegeben und anschließend geprüft.
Bei der letzten Kontrolle werden die Ergebnisse ausgewertet und entschieden, ob die Einreise genehmigt oder verweigert wird.
Nicht verstanden habe ich, warum man die Leute so menschenunwürdig behandelt.
Ich habe an anderer Stelle geschrieben, dass anscheinend alle Soldaten das Holocaustmuseum in Jerusalem besuchen müssen. Dort wird ihnen gezeigt, wie brutal und menschenverachtend die Nazis mit den jüdischen Mitbürgern umgingen. Verbal verhielt man sich – so mein Eindruck – an diesem Checkpoint gegenüber den Palästinensern nicht anders.
Wer sich weiter informieren möchte:
http://www.j-zeit.de/archiv/artikel.1391.html
http://arendt-art.de/deutsch/palestina/texte/checkpoint_1.htm
http://www.heilig-land-verein.de/Einrichtungen/Beit_Emmaus/Damals_und_heute/Emmaus-
Viele Grüße
Joachim (Mauer)
E-Mail vom 20.11.2012
Liebe Freunde,
ich möchte Euch über einen weiteren Abschnitt unseres Israel/Palästinaaufenthaltes berichten.
Als wir aus dem Checkpoint bei Al Jalamah herauskamen, wollten wir bis zur nächsten Bushaltestelle gehen, um nach Nazareth zu fahren.
„Vielleicht werdet Ihr Euch jetzt fragen: Wieso Nazareth? Da ward ihr doch schon mit dem Bus des Hotels Jerusalem!“ Das ist richtig. Doch dieses Mal sollte die Stadt Beginn einer dreitägigen Wanderung mit dem Namen „Jesus Trail“, also Jesus Pfad, sein.
Doch zunächst zurück zum Checkpoint. Mittlerweile war es halb fünf, und es dämmerte schon. Die Information, die wir hatten, war, dass die Bushaltestelle etwa 1 km entfernt in einem kleinen Wald läge. Wir konnten sie jedoch nicht ausmachen.
Jean-Pierre schlug vor, dass wir uns ein Taxi nehmen, das uns zum Busbahnhof nach Afula, der nächsten Stadt, bringen sollte. Ich wollte unbedingt weiter laufen und fuhr ihn an: „Du nervst mich!“ Da kam bei mir der Ärger und Frust der Checkpointpassage hoch und Jean-Pierre bekam das ab.
Gott sei Dank kam ich noch rechtzeitig zur Vernunft; denn in der Dunkelheit eine Bushaltestelle zu finden und dann noch warten zu müssen, machte wenig Sinn. Zumal sich ein Taxi näherte. Der Taxifahrer war clever und geschäftstüchtig. Zunächst stellte er die übliche Frage, aus welchen Ländern wir kämen und anschließend, wo er uns hinfahren sollte. Hier der Dialog: „Busbahnhof Afula!“ „OK! “ Nach einiger Zeit: „Wo wollt ihr mit dem Bus hin?“ „Nach Nazareth!” „Ich mache euch einen Vorschlag. Ich fahre euch dorthin, das wird für jeden von euch wohl 50 Schekel (10 EUR) teurer. Doch ich bringe euch dafür auch direkt zur Unterkunft.“ Wir waren sofort einverstanden und in etwas mehr als einer halben Stunde am Kreisel am Fuße der Verkündigungskirche in Nazareth. Er fuhr uns zur Unterkunft am Rand der Altstadt. Doch es sollte sich später herausstellen, dass es die Falsche war.
An der Rezeption sagten wir, dass wir reserviert hätten und der nette Inhaber checkte uns ein.
Unsere tagtägliche Prozedur begann: Wäsche waschen, gewaschene Wäsche in ein Handtuch fest einwickeln zum Vortrocknen, duschen, im Zimmer die Wäscheleine anbringen und vorgetrocknete Klamotten auf die Leine. Was das Leineanbringen betraf, war ich mittlerweile geübt: Türscharniere, Kleiderstangen in Schränken und Stromkabel findet man als Befestigungsmöglichkeiten immer. Ab und zu habe ich auch Bilder abgehängt, um die Leine an den Wandhaken zu befestigen (die manchmal abgingen). Wir waren stolz darauf, dass wir während unserer gesamten Wanderzeit täglich Unterwäsche, Strümpfe und T-Shirt gewaschen haben, alles trocken bekamen und somit wenig nach Schweiß rochen. Ich bin da von zahlreichen Wanderern und Pilgern anderes gewohnt.
Als wir nach einem reichlichen Abendessen und einer Flasche Wein intus zur Herberge zurückkamen, vermeldet der freundliche Herr an der Rezeption ein „big problem“. Die Herberge eine Straße weiter hätte angerufen und nach uns gefragt. Wir hätten verbindlich dort gebucht und wenn wir nicht kämen, müssten wir trotzdem bezahlen. Was blieb uns anderes übrig, als die Wäsche abzuhängen, die Rucksäcke zu packen und umzuziehen.
Fauzi Azar Inn hieß die Unterkunft und sie ist eine Wucht. Von der Straße aus gibt es nur ein Tor in einer Mauer. Wenn man dort eintritt, erwartet einen eine riesige, alte arabische Villa aus dem 18. Jahrhundert
mit bemalten Decken und Marmorböden, die geschmackvoll renoviert und als B&B umgebaut wurde.
Unten im Parterre befindet sich ein Innenhof mit Sitzgelegenheiten. Frühstücksraum und Aufenthaltsräume schlossen sich an. Über eine Treppe geht es hinauf zu einer Halle, die Rezeption, Geschäft, Internet- und Verweilgelegenheit gleichermaßen ist. Dahinter liegen die Dortoirs (Schlafräume).
Was ich bisher noch nicht festgestellt hatte, wurde mir hier gewahr. Auch in Israel gibt es Trecker und Fußpilger.
Auf den „Jesus Trail“ war ich eher durch Zufall gestoßen. Im Tourismusbüro in der Jerusalemer Altstadt hatte ich gefragt, ob man im Land auch wandern kann. Da drückte man mir ein Prospekt in die Hand, in dem der Wanderweg erwähnt wird. Er beginnt in Nazareth, führt über Kanaa und endet in Kafarnaum am See Genezareth. Gesamtlänge: 65 km.
Im Matthäusevangelium soll es heißen: „ Er (Jesus) verließ Nazareth, um in Kafarnaum zu wohnen, das am See liegt, im Gebiet von Sebulon und Naftali.“
Fauzi Azar, der jüdische Betreiber der Gästehauses und David Landis, sein christlicherFreund aus Amerika hatten vor einigen Jahren die Idee, eine Route zu planen, die es Reisenden ermöglichen sollte, jenseits des Massentourismus, jenseits von Reisebussen und Anstehen in Kirchen, das Heilige Land zu erkunden und zwar auf einer Wanderstrecke, die den Spuren Jesu folgt. Man kann dies alleine tun oder mit einem „Tourguide“, den man in der Herberge

bemalte Decke im Schlafsaal
buchen kann.Ich hatte mir vorher schon Gedanken gemacht, ob ich mit den dürftigen Angaben des Tourismusbüroprospektes den Wanderpfad finden und ihm über 65 km folgen könnte, ohne mich zu verlaufen. Als wir einchecken, finde ich auf dem Schreibtisch der Rezeption ein Buch mit dem Titel „Hiking the Jesus Trail“. Es war wohl in Englisch, aber ähnlich wie in Italien, wo wir mit einem Topoguide in Italienisch auf der „Via Francigena del Sud“ wanderten, liest man sich ein und versteht irgendwie das meiste. Und so war es auch dieses Mal: Mit dem Büchlein waren wir auf der sicheren Seite.
Wir teilten unser Zimmer mit zwei männlichen und einer weiblichen Person, allerdings gewaltig jünger als wir. Am nächsten Morgen beim Frühstück lernten wir die weibliche Zimmergenossin kennen. Sie war Deutsche, sprach vier Sprachen und arbeitete als Freiwillige in der Herberge mit. Von ihr bekamen wir noch wertvolle Tipps.
So konnte es endlich losgehen. Für mich war dies ein großes Bedürfnis; denn während unseres bisherigen Israel/Palästina-Aufenthaltes stand Wandern noch nicht auf dem Programm.
Gleich am Hotel entdeckten wir die erste Wegmarkierung: Zwei weiße Streifen mit einem orangefarbenen in der Mitte sind an eine Hauswand gezeichnet. Diese Wegweiser führen uns durch die Altstadt von Nazareth, die recht verschlafen wirkt, da alle Läden noch geschlossen sind. Die erste kleine sportliche Herausforderung beginnt: Kleine Gässchen mit zahlreichen Stufen führen uns hinauf in die Oberstadt. Wir
werden für unsere Anstrengung entschädigt mit Blicken hinunter in die Altstadt mit der Verkündigungskirche und über uns ein strahlend blauer Himmel.
Als wir aus der Stadt herauskommen, endet der Jesus Trail vor einem Zaun und einer Großbaustelle dahinter. Doch die Karten im Reiseführer helfen uns weiter. Wir steigen hinab ins Tal und können danach sogar eine verkehrsreiche Straße umgehen und einem Olivenhain folgen. Nach einer Straßenkreuzung geht es dann auf einem Feldweg weiter. Links und rechts liegen abgeerntete Felder und dazwischen immer wieder Oliven.
Und da ist es passiert. Irgendwie haben wir eine Wegmarkierung übersehen. Etwa zwei Kilometer gehen wir weiter und merken, dass wir falsch sind. Wir bemerken eine Gruppe von Frauen, die Oliven abpflücken. Ein älterer Bauer, er heißt Resek Fuad „überwacht“ das Ganze. Mit meinem gebrochenen Englisch frage ich Herrn Fuad nach dem Weg. Irgendwie merkt er, dass ich Deutscher bin und antwortet mir in Deutsch. Später sagt er mir, dass er vor vielen Jahren für einige Zeit in
Deutschland gearbeitet hat. Eine der Frauen eilt zum Auto und holt eine große Plastikflasche heraus. Das Wasser darin ist zu Eis gefroren. „Hier nehmt das mit! Ihr müsst trinken!“ Außerdem gibt sie Jean-Pierre eine Tüte. In ihr befinden sich zahlreiche Kuchenstückchen, die wir von Palästina her schon kennen. Ein wenig war der Inhalt der Plastikflasche getaut und wir tranken. Das Wasser war mit Zitronensaft angereichert. Ein wahrer Durststiller! Eine gute Idee, das Getränk einzufrieren. So bleibt es immer kühl.
Der Weg zu unserem nächsten Ziel, dem Nationalpark von Zippori, erklärt uns Herr Fuad genau. Zum Schluss fragen ich ihn scherzhaft: „ Ihre Frauen pflücken die Oliven und sie überwachen die Arbeit?“ „Nein, “ sagt Resek Fuad, „ich habe die Arbeit genau aufgeteilt. Ich fahre den Traktor und das Auto und meine Frauen, Töchter und Schwiegertöchter besorgen das Ernten!“
Bei dem Nationalpark von Zippori handelt es sich um die alte Stadt Sephorris, die zu Jesu Zeiten bedeutender und größer war als das eher dörfliche Nazareth. Heute ist es umgekehrt. Nazareth, als Heimatstadt von Christus, profitiert enorm von dieser Bedeutung, während Sephorris nur als Ruinenstadt mit schönen Fußbodenmosaiken von sich reden macht.
Auf und ab durch Wälder und Felder geht es nach Kanaa, der Hochzeitsstadt. Wir stehen wie schon vor acht Tagen vor dem verschlossenen Gitterportal der Hochzeitskirche. Nach einer Mittagsrast in einem kleinen Restaurant in der Nähe nehmen Jean-Pierre und ich verschiedene Wege. Mein Mitpilger verlässt den Jesus Trail und nimmt die Straße in Richtung des Kibbuz Lavi, unserem Etappenziel des heutigen Tages. Ich folge dem Jesus Pfad, marschiere auf den höchsten Punkt Kanaas und dort weiter mit einem wunderbaren Weitblick auf die Berge Galiläas.
Ich treffe Jean-Pierre wieder vor dem Kibbuz und gemeinsam gehen wir in den Ort hinein zum Hotel, wo wir gebucht hatten. Ich habe 32 Tageskilometer in den Beinen, mein Begleiter etwas weniger.
Viele Grüße
Joachim (Mauer)
E-Mail vom 22.11.2012
Liebe Freunde,
hier nun die Fortsetzung des Berichtes über unsere Wanderung auf dem Jesus Trail.
Ein Schwimmbad gibt es auch. Doch ich konnte mich nicht dazu entschließen, dort zu baden. Der Wasserverbrauch des Hotelbetriebes ist ohnehin schon sehr groß. Ein Schwimmbad ist meiner Meinung ein verzichtbarer Luxus angesichts der Wasserknappheit. Ich musste an Rania und ihre Familie in Nablus denken, für die jeder Tropfen Wasser – da Mangelware – ein kostbares Gut ist. Es ist von Nablus gerade mal 60 km Luftlinie nach Lavi.
Im Hotel treffen wir eine 15 köpfige französische Gruppe, die acht Tage mit Führer auf dem Jesus Trail wanderte. Sie waren für die gesamte Zeit dort einquartiert und ließen sich täglich mit dem Bus zu den Tagesetappen fahren. So konnten sie sich – anders als wir – mit leichtem Marschgepäck auf den Weg machen und ihre Klamotten im Hotel lassen. „Jeder geht SEINEN Weg“, denke ich.
Wir erfahren von einem Mitglied der Gruppe, dass am gleichen Abend eine Info-Veranstaltung in französischer Sprache über den Kibbuz im Allgemeinen und Lavi im Besonderen stattfindet. Wir können daran teilnehmen.
Ein in Lyon geborenes und aufgewachsenes Kibbuzmitglied, steht uns Rede und Antwort. Seine allgemeinen Ausführungen möchte ich hier nicht wiedergeben. Man kann sie nachlesen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Kibbuz
http://www.spiegel.de/deinspiegel/a-798158.html
Vieles erinnert mich an die Kolchosen, also das sozialistische Modell: Alle bekommen den gleichen Lohn und die Rundumversorgung. Aber einen wesentlichen Unterschied stelle ich schon fest. Die im Kibbuz sind, sind freiwillig dort. Unser Referent seit über 20 Jahren. Er zögert, als ich ihn frage, ob er es bereut hat. „Jetzt nicht mehr“, ist seine Antwort. „Doch es gab auch Zeiten, wo ich wieder gehen wollte. Aber so ist das Leben überall. Es gibt Höhen und Tiefen.“
Er erzählt, dass manches Kibbuzim sich aufgelöst hat, da die Jugend nicht mehr mitmachen wollte. Hier in Lavi, sei dies noch nicht der Fall.
Ich gestehe, dass ich mir ein Leben im Kibbuz gut vorstellen kann, obwohl ich denke, dass Idealismus und Frömmigkeit auch ihre Grenzen haben. Warum sollte derjenige, der viel leistet, nicht etwas mehr bekommen? Gut ist, dass im Kibbuz niemals jemand 50 oder 100-mal mehr verdienen kann – wie mancher Manager bei uns – und jeder ein ausreichendes Auskommen hat.
Am nächsten Morgen sehen wir neben dem Hotel die Wohnhäuser und außenherum riesige Ställe mit Pferden und Kühen. Für letztere gibt es große Ventilatoren gegen die Hitze.
Als wir Lavi verlassen, wandern wir zunächst durch weite Felder, die alle noch zum Kibbuz gehören. Mir imponiert, was da alles während der 60 Jahre des Bestehens aus dem Boden gestampft wurde.
Wir steigen auf einen Berg, den „Horns of Hattin“. Es ist ein erloschener Vulkan, und er ragt wie ein Büffelhorn aus der südgaliläischen Hattinebene. Einige Bibelgelehrte glauben, dass Jesus hier seine Bergpredigt gehalten hat. Hoffentlich hat er dies nicht auf dem Bergrücken getan, denn der war voller Felsgestein, und wir hatten Mühe, darüber und anschließend hinabzusteigen.
Belohnt wurde unsere Mühe mit dem – meiner Meinung nach – schönsten Stück des Jesus Trails. Wir folgen in einem Tal einem Wadi, der etwas Wasser führte. Es ging durch uralte Olivenhaine und an Obstbäumen und Palmen vorbei. Das Tal wurde enger und dennoch gab es noch kleinere Weiden auf denen Kühe standen. Wir sehen einen Priester, vom Aussehen her ein Südamerikaner, meditierend unter einem Ölbaum sitzen. Vielleicht geht es ihm so wie Jean-Pierre, der sich gut vorstellen kann, wie sein göttlicher Freund durch dieses Wadital ging, als er seinen Mitstreiter Petrus und dessen Familie am See Genezareth besuchte. Etwas unterhalb treffen wir drei Spanier. Sie sorgen sich um den Verbleib ihres Pfarrers. Wir können sie beruhigen.
Wir hätten bis zum Ende des Tales weitergehen können und wären nach wenigen Kilometer am See gewesen. Doch die Wegmarkierung führte uns 200 Höhenmeter steil hinauf zum Nationalpark „Berg Arbel“. Mein kleines Taschenthermometer zeigte 38 Grad. Da waren wir natürlich sehr froh, dass wir am Parkeingang einen Kiosk mit Sitzgelegenheit fanden.
Wir waren jedoch nicht allein. 12 pubertierende Jugendliche vertrieben sich die Zeit. Das Handy war ununterbrochen in Betrieb. Es wurde ausgelassen gelacht und sich wenig später angeschrien. Ein Pärchen legte sich auf den Tisch und knutschte. Die anderen saßen um sie herum und störten sich nicht daran. Diese israelischen jungen Leute unterschieden sich in nichts von vielen ihrer Altersgenossen hier bei uns. Ich fragte mich nur, wieso die an einem normalen Werktag hier und nicht in der Schule waren. Später fand ich dann des Rätsels Lösung. Da das Kraxeln im Nationalpark nicht ganz ungefährlich ist, hat der Lehrer seine Klasse in zwei Hälften eingeteilt. Mit der ersten war er unterwegs.
Von hier oben hatte man einen tollen Blick nach Osten über den See hinweg zu den Golanhöhen, nach Norden bis zur Grenze mit dem Libanon und wären nicht die Berge dazwischen gewesen, hätte man auch im Westen Haifa und das Mittelmeer gesehen, gerade mal 50 km Luftlinie entfernt.
Der Abstieg hinunter zum Dorf Wadi Hamam war mit Klettern verbunden. Jean-Pierre, der nicht ganz schwindelfrei ist, musste all seinen Mut zusammen nehmen.
Der Fels sah aus wie ein Schweizer Käse, überall waren Höhlen zu sehen. Die waren alle einmal bewohnt.

Höhlenwohnungen
Die letzten Kilometer ging es durch große Plantagen mit einem ausgeklügelten Bewässerungssystem, und wir kamen nach Migdal.
Hier übernachten wir in einem christlichen Gästehaus, das von zahlreichen freiwilligen Mitarbeitern betreut wird. Eine kanadische Pilgergruppe saß auf gepackten Koffern. Sie war wohl einige Tage hier einquartiert. Wir nahmen mit ihnen das Abendessen ein. Es war ein Abschiedsessen; denn der Bus brachte sie anschließend zum Flughafen. Es hatte sich in der Zeit ihres Aufenthaltes ein herzliches Verhältnis zu den Freiwilligen Mitarbeitern entwickelt und die Umarmungen zum Abschied nahmen kein Ende.
Die Kommunikation mit uns war nicht einfach, da man nur Englisch sprach. Dennoch konnten wir ihnen ein bisschen von uns erzählen. Einer der Gruppe, sagte, als er erfuhr, dass ich aus Deutschland komme: „Germany is bad.“ Ich verstand nicht, was er damit meinte. Dennoch ging mir sein Satz noch einige Zeit im Kopf rum.
Da die Herberge rauch- und alkoholfrei war, gingen wir nach einem Spaziergang in eine kleine Kneipe. Der Wirt sagte nicht: Germany ist bad. Er wiederholte sich mit dem Satz: Germany is wonderful. Ich versuchte herauszubekommen warum. Da nannte er mir auswendig die meisten Fußballvereine der Bundesliga und zahlreiche Spieler.
Am nächsten Tag waren es dann nur noch etwa 10 km bis zum Ende des Jesus Trail: Die Brotvermehrungskirche in Kafarnaum heute Tagba. Da wir dort schon waren, machten wir nur eine kurze Rast und beobachteten die vorbeiziehenden Pilgergruppen: Eine Gruppe aus Nigeria hatte sich eine bunte Einheitskleidung schneidern lassen. Obwohl manche doch recht wohlgenährt waren, sahen sie sexy aus; denn die Pfunde waren in der Kleidung gut versteckt. Das konnte man von manch anderen Frauen nicht behaupten: Hot pants, enge nabelfreie T-Shirts mit großem Ausschnitt legten Rettungsringe und Schwabbelfett frei. „Jeder blamiert sich, so gut er kann“, dachte ich mir.
Interessant auch so einige Pilger aus Japan. Einer hatte seine Sonnenbrille ganz vorne am Schirm seiner Mütze befestigt. In dem Zwischenraum zwischen Sonnenbrille und Gesicht brannte die Sonne. Der letzte Schrei bei einigen Japanerinnen ist die Gesichtskleidung. Aus dem Fernsehen wusste ich, dass viele einen Mundschutz tragen als Feinstaubschutz. Hier bemerkte ich einige, die unter den Augen einen Vorhang aufgehängt hatten, der fast das ganze Gesicht bedeckte. Man sagte mir, dass dieser Schutz gegen Sonnenbräune bieten soll. Die Haut muss weiß bleiben. Eine Frau sah ich, die hatte diesen Vorhang und zusätzlich noch einen Sonnenschirm. Doppelt genäht hält besser.
Da wir noch am gleichen Tag mit dem Bus nach Jerusalem zurückwollten, begaben wir uns zur nächsten Bushaltestelle, um zunächst nach Tiberias zum Busbahnhof zu fahren. Nicht nötig. Kaum standen wir da, hielt schon ein Auto an und nahm uns mit. Es war ein Israeli aus Kiryat Smona, der nördlichsten Stadt Israels nahe der Grenzen zum Libanon und zu Syrien gelegen. Das Beste an der Fahrt war die Musik im Auto. Unser freundlicher Fahrer war Fan der ABBA’S: „I have e dream.“ Ich fühlte mich an meine Togozeit vor mehr als 30 Jahren erinnert.
Man brachte uns zum Busbahnhof von Tiberias und wollte nichts dafür haben. Der Bus fuhr pünktlich um 13 Uhr ab und füllte sich auf der Fahrt. Zahlreiche junge Soldaten auf dem Weg ins verlängerte Wochenende waren mit von der Partie. Viele hatten ihr Maschinengewehr umhängen. Dies war mir schon oft aufgefallen. Ich nehme an, dass sie so im Ernstfall nicht erst in die Kaserne müssen, um ihre Waffe zu holen, sondern direkt zum Einsatzort eilen können. Auf halber Strecke hielt der Bus wegen Motorschaden an. Es dauerte einige Zeit, bis wir in den nächsten einsteigen konnten, der dann rappelvoll war. Wir hatten zunächst nur einen Stehplatz, doch zwei jungen Soldaten in Kampfmontur boten uns ihren Sitzplatz an. Es ist unter den Israelis und Palästinenser noch ein guter Brauch, dass Jüngere den Älteren ihren Sitzplatz überlassen. Ich finde das toll!
Trotz Buspanne kamen wir gegen 17 Uhr an der Central Station in Jerusalem an.
Viele Grüße
Joachim (Mauer)
E-Mail vom 23.11.2012
Liebe Freunde,
keine Pilgerreise nach Israel lässt den Geburtsort Jesu in Bethlehem aus. Auch bei Jean-Pierre und mir war das so.
Bethlehem liegt im Süden von Jerusalem und beide Städte grenzen aneinander. Da Bethlehem sich bereits im West-Jordanland befindet, zieht sich die Mauer wie ein Bandwurm an der Grenze entlang. Ich hatte den Eindruck, dass sie mindestens so hoch ist wie mein Einfamilienhaus in Mehren.
Wir wollten mit dem Bus zum Checkpoint fahren, diesen zu Fuß passieren und dann mit einem palästinensischen Kleinbus nach Bethlehem hinein.
An der Bushaltestelle fing uns ein in Jerusalem lebender Palästinenser ab. Das Gespräch begann wie schon so oft: „Wie geht es?“ „Gut.“ „Wo kommt ihr her?“ „Belgien und Deutschland.“ „Wo wollt ihr hin?“ „Nach Bethlehem mit dem Bus.“ „ Da müsst ihr zweimal umsteigen und zu Fuß durch den Checkpoint. Fahrt mit mir im Taxi. Ich zeige euch alles. Und ich mache euch einen guten Preis.“
Erst wollte ich nicht, ließ mich aber umstimmen. Zumal das Preis-/Leistungsverhältnis zu stimmen schien. In der Tat, wir kamen ohne Probleme durch den Checkpoint und 15 Minuten danach stiegen wir vor der Geburtskirche aus. Es war Samstagmorgen gegen halb 10. Ein guter Zeitpunkt, da die meisten Touristen noch in ihren Hotels beim Frühstück waren oder sich gerade auf den Weg machten. Wir wurden durch einen Nebeneingang geschleust und umgingen die überschaubare Schlange am Kirchenportal. Schnellen Schrittes durchquerten wir das Kirchenschiff und standen vor der Steintreppe, die hinab zur Krippenkrypta führt. Da hatte sich eine Menschentraube gebildet, aber es ging voran, Stufe für Stufe bis zum Eingangsportal. Dahinter gab es weitere Stufen hinab in die Tiefe.
Den Krippenraum sah ich noch nicht. Doch ich hörte Stimmen aus der Tiefe, die auf Deutsch das Lied sangen: „Stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft. Einsam wacht nur das traute, hochheilige Paar. Holder Knabe im lockigen Haar schlaf’ in himmlischer Ruh’, schlaf’ in himmlischer Ruh’.“ Ich hatte das Gefühl, am Bescherabend auf der Couch bei mir zu Hause zu sitzen.
Als ich mich bis in die Krypta vorgeschoben hatte, sah ich rechts den Altar. Jeder, der an ihn herantrat, ging in die Knie und kroch darunter; denn dort soll die Krippe gestanden haben.
Gott sei Dank bin ich noch einigermaßen gelenkig; den Fotoapparat hatte ich parat. In die Knie, kriechen, knipsen und wieder hoch. Ich bin wohl nicht dazu geschaffen, an einer solch weltberühmten Stelle Emotionen zu zeigen. Da war Jean-Pierre ganz anders. Sichtlich bewegt kroch er unter den Altar und verweilte einen Moment im Gebet.
Neben dem Altar stand ein Pope, der ein schönes Ikonenbildchen „Maria mit Kind“ verteilte. Ich wollte auch eines. Er hielt die Kostbarkeit in der Hand und fragte barsch: „Orthodox?“ Ich: „No Orthodox.“ Er: „No picture.“
Er gab mir dann doch das Heiligenbildchen, ohne dass ich zum orthodoxen Glauben übertreten musste.
Die Stille-Nacht-Gesangsgruppe hatte sich in einer winzigen Kapelle gegenüber der Krippe versammelt und wohnte einer Messe bei. Weihnachtslieder hörte ich nicht mehr.
Wir verließen die Geburtskirche und unser umtriebiger Reiseführer zeigte uns noch die Moschee von Bethlehem, die gegenüber lag.
Danach ging es zur Muttermilchkirche. So was hatte ich noch nie gehört. Tatsächlich gibt es eine Kapelle mit angeschlossenem Franziskanerkloster, wo die Muttermilch der Muttergottes verehrt wird. In einer Ecke schaut ein Fels heraus, wo das Stillen stattgefunden haben soll. Mir kam ein ganz profaner Gedanke: “Ob es auch eine Stelle gibt, wo die Windeln gewechselt wurden?“
Unser Taxi bringt uns in die heutige Realität zurück. Wir fahren zur Mauer und an ihr entlang. An einer Stelle wurde sie inmitten einer Straße errichtet. Wir drängeln uns in der restlichen Hälfte an Touristenbussen vorbei. An einer Stelle hat man den „Wall“ um ein Wohnhaus herumgebaut. Die Bewohner schauen an drei Seiten auf Beton. In regelmäßigen Abständen gibt es Wachtürme.
Mittlerweile hat sich ein Mauertourismus entwickelt: Andenkenläden mit Mauersouvenirs und Restaurants mit Mauerblick. Unser geschäftstüchtiger Reiseführer schleppt uns zu beiden hin. Im Restaurant haben wir etwas getrunken. Zum Kauf eines Mauersouvenirs konnte ich mich nicht entscheiden.
Mit unserem Reiseführer handelten wir aus, dass er uns auch ins 35 km entfernte Hebron bringen sollte. Obwohl die Strecke ausschließlich auf palästinensischem Gebiet liegt, unterliegt ein Teil der israelischen Polizeigewalt. Die Polizisten achten darauf, dass die Leute in den Autos angeschnallt sind. Wenn nicht, gibt es ein Knöllchen.
Genau an dem Punkt, wo die Palästinenser zuständig sind, macht es plötzlich: Klick! Klick! Unser Steuermann sowie der Reiseführer entschnallen sich. Es stört sie auch nicht, dass eine gelbe Warnlampe aufleuchtet und das Piepsen immer lauter wird. Als wir zurückfahren, vollzog sich die gleiche Zeremonie, nur umgekehrt. Die beiden wollten uns sagen: „Schaut her, wir sind in Palästina, da haben die Israelis nichts zu sagen.
Hebron hat heute über 200.000 Einwohner. Die Stadt wurde geteilt in die Zone H1 (palästinensisch kontrolliert) und die Zone H2 (israelisch kontrolliert). Letztere befindet sich in der Altstadt. Vom Parkplatz unseres Autos gingen wir zunächst durch einen Basar und standen plötzlich vor einem Checkpoint mit Sprengstoffschnüffler und Piepsrahmen. Dahinter setzt sich eigentlich die Altstadt fort. Doch die arabischen Geschäfte sind geschlossen. Palästinenser dürfen sich hier nicht aufhalten. Es sei denn, sie haben – da Anwohner –Sonderausweise. In diesem Bereich gibt es etwa 500 größtenteils militante Siedler, die von 1000 israelischen Soldaten bewacht werden.
Wir können uns relativ frei bewegen. Die Soldaten verhalten sich uns gegenüber korrekt. Auf einer kleinen Anhöhe liegt die nach dem Tempelberg in Jerusalem heiligste Stätte von Juden und Moslems. Hier sollen Abraham, Sara, Isaak, Rebekka, Jakob und Lea begraben sein. Ein langgestrecktes Gebäude ist links eine Moschee und rechts eine Synagoge. Es gibt abgesicherte und getrennte Zugänge. Uns wurde der Zutritt verweigert.
Wir gehen, beobachtet von Soldaten, zu einem Andenkenladen mit Wohnhaus. Es ist der einzige Laden, der nicht geschlossen wurde. Warum konnte ich nicht herausfinden. Der Besitzer ist ein junger Palästinenser, der mit seiner Frau und seiner einjährigen Tochter auch hier wohnt. Seinem Vater wurde von einem amerikanischen Juden viel Geld geboten, wenn er verkaufen würde. Er hat dies abgelehnt.
Der junge Mann führte uns in ein Hinterzimmer und legte ein Video ein. Darin werden Zusammenstöße von Juden und Palästinensern gezeigt. Gezeigt wird auch ein muslimischer Friedhof. Der Eingang liegt auf der für Palästinenser gesperrten Straße. Sie können ihn nur über einen weiten Umweg erreichen. Die Straße, früher ein umtriebiges Geschäftsviertel, wirkt wie ausgestorben, sieht man von den Militärs ab, die Wache schieben und von vereinzelnten Fahrzeugen mit Siedlern (israelisches Kennzeichen).
Als wir uns von dem jungen Palästinenser und seiner Frau verabschieden, gingen gerade zwei jugendliche Siedler vorbei. Vorher hatten wir erfahren, dass solche Halbwüchsige schon mal Steine in den Andenkenladen werfen. Ich schaute ihnen in die Augen und war erschrocken. Ich hatte den Eindruck, sie waren voller Abneigung uns und vor allem den beiden Anwohnern gegenüber.
Wir fuhren zurück in Richtung Jerusalem. In Bethlehem bestiegen wir den Bus nach Jerusalem. Alle Sitzplätze waren belegt. Wir waren etwa 15 Personen, die keinen Platz bekamen. Die Passagiere waren meist junge Leute, ich vermute Studenten oder Kinder von Siedlern. Niemand bot uns einen Sitzplatz an. Ungewohnt! Später fand ich heraus warum.
Am Checkpoint hielt der Linienbus. Ein Teil der Passagiere stieg aus. Erst später kapierten wir, dass es diejenigen waren, die einen Stehplatz hatten.
Jean-Pierre und ich blieben im Bus. Zwei Soldaten stiegen ein. Der erste hatte eine Sonnenbrille auf und ein Maschinengeweht in der Hand. Mit diesem fuchtelte er in unsere Richtung. Wegen der Sonnenbrille konnte ich nicht feststellen, ob er uns meinte. Ich zeigte auf mich selbst und sah zu ihm. Ein erneutes Fuchteln mit dem Gewehr folgte. Jetzt kapierte ich. Wir sollten raus gehen. Wir verließen also den Bus und warteten mit den anderen. „Was passiert jetzt?“ fragte ich mich. Die Türen schlossen sich. Durch die Fenster sah ich, wie die verbliebenen Insassen kontrolliert wurden. Danach öffnete sich die Vordertür. Sofort stellten sich die draußen Wartenden hintereinander auf. Wir schlossen uns an. Die beiden Soldaten stiegen aus und begannen uns nacheinander zu kontrollieren. Die Kontrollierten konnten wieder einsteigen.
Jetzt hatte ich die Prozedur verstanden: Dadurch dass der Gang komplett geräumt war, konnten sie sicher sein, jeden kontrolliert zu haben. Eigentlich logisch. Hätte man uns dies nicht kurz erklären können, anstatt mit dem Gewehr herumzufuchteln?
Und ich weiß auch, warum uns die jungen Herrschaften keinen Sitzplatz anboten. Man wollte den Bus nicht verlassen müssen.
Viele Grüße Joachim (Mauer)
E-Mail vom 24.11.2012
Liebe Freunde,
Rudolf Rogg hatte uns kurz nach unserer Ankunft in Jerusalem ein Projekt gezeigt, das mit deutscher Entwicklungshilfe finanziell und mit einer Entwicklungshelferin auch personell unterstützt wird. Entwicklungshilfeminister Dirk Niebel hat es in Begleitung von Rudolf Rogg zu Beginn des Jahres besucht.
Es handelt sich um das einzige offizielle Gemeindezentrum im arabischen Stadtteil SILWAN in Ost-Jerusalem. Silwan liegt gegenüber dem Tempelberg hat 40.000 Einwohner und ist vom israelisch-palästinensischen Konflikt in besonderem Maß betroffen. Immer wieder kommt es hier zu gewaltsamen Auseinandersetzungen.
Ich verabredete mich an einem späten Vormittag mit der Entwicklungshelferin, die sich dankbarerweise bereit erklärt hatte, mir ihr Projekt zu zeigen. Wir trafen uns am Dungtor der Jerusalemer Stadtmauer. Von dort aus geht man die Straße in südlicher Richtung hinab und ist nach wenigen hundert Meter in Silwan.
Der aktuelle Konflikt entzündet sich u.a. an dem Vorhaben der Stadtverwaltung von Jerusalem auf dem Gebiet von SILWAN einen „Archäologischen Garten“, auch Bibelpark genannt, anzulegen, da man in diesem dem Tempelberg vorgelagerten Gebiet Funde aus der Zeit König Davids machte bzw. weitere – wie unterirdische Wasserwerke aus der damaligen Zeit – vermutet. Die Stadtverwaltung möchte, um diesen Park einzurichten, über 80 Häuser entfernen. Die Eigentümer sollen dies auf eigene Kosten tun oder, wenn sie sich weigern, die Abrisskosten bezahlen. Die Position der Stadtverwaltung, es handele sich um illegal errichtete Häuser ist höchst umstritten und beschäftigt die Gerichte.
An zahlreichen Stellen werden unter den Häusern Tunnel gebohrt, um nach archäologischen Überresten zu suchen. Die Grabungen führen dazu, dass sich die Erde an verschiedenen Stellen absenkt. An zahlreichen Häusern gibt es Setzrisse und es besteht Einsturzgefahr.
Die Eingänge zu den Tunnels sind mit einem Zaun versehen. In oder vor einem Wachhäuschen auf einem Gebäudedach mittendrin befindet sich Tag und Nacht ein Beobachter. Videokameras sind installiert und zeichnen alles auf, was sich in dem umliegenden Wohngebiet abspielt.
Siedler (Settlemans) haben sich in Silwan Häuser gekauft. Sie demonstrieren ihr Judentum mit David-Stern-Fahnen und igeln sich ein. Kameras, die nicht auf ihr Grundstück, sondern auf die arabischen Nachbarn gerichtet sind, sollen schützen und warnen vor Angriffen. Die Siedler werden dabei von Militär und Polizei gestützt und beschützt.
Auf den Höhen oberhalb und rundum befinden sich jüdische Siedlungen.
Silwan wurde 1967 annektiert und der Stadtverwaltung Jerusalems unterstellt. Es ist Ziel der derzeitigen Politik Israels, diesen arabischen Ort mit jüdischen Siedlern zu durchsetzen, so dass er bei Friedensverhandlungen nicht mehr als „Verhandlungsmasse“ zur Verfügung steht.
In all dem liegt der Grund für das aufgeheizte Klima und die Zusammenstöße in Silwan. Oft beteiligen sich daran auch Jugendliche und Kinder insbesondere als Steinewerfer.
Da ich gegen jede Art von Gewaltanwendung bin, lehne ich dieses Verhalten ab. Allerdings lehne ich auch ab, wie Polizei und Militär darauf reagieren.
Sie dringen meist nachts unangemeldet in die Häuser von verdächtigen Jugendlichen und Kindern, nehmen diese gewaltsam fest und bringen sie weg. Auf der Polizeistadion werden sie bis zu 48 Stunden festgehalten und danach wieder frei gelassen. Eltern oder andere Angehörige dürfen während der Haft nicht zu ihnen. Oft wird bei den Verhören Gewalt angewendet.
Die Entwicklungshelferin, Psychotherapeutin von Beruf, nimmt mit betroffenen Jugendlichen und Kindern Kontakt auf und dokumentiert, was vorgefallen ist. Ihre Statistik weist über 300 Fälle pro Jahr aus.
Ursprünglich war es vorgesehen, dass sie die Betroffenen, die oft traumatisiert sind, therapiert. Dies tun jedoch Einheimische Fachkräfte, da sie die Sprache der Kinder besser sprechen, das Milieu genauer kennen und so näher an die Kinder bzw. Jugendlichen herankommen.
Die Beratungsangebote sollen Kindern und Jugendlichen helfen, eigene Gewalterfahrungen zu bewältigen und ihre Gewaltbereitschaft in diesem konfliktiven Umfeld zu reduzieren.
Das Jugendzentrum will darüber hinaus durch Freizeitangebote ein gewaltfreies Miteinander fördern und einüben und neue Perspektiven eröffnen.
Das Zentrum wird von Jawad Siyam geleitet, der schon häufig bei gewaltsamen Auseinandersetzungen vermittelnd und deeskalierend eingeschritten ist.
Vorhanden ist eine Bibliothek und ein Computerraum. Von Theater über Musik bis hin zu Sprach- und Computerkursen gibt es ein breites Angebot. Bis zu 650 Kinder und Jugendliche sowie mehr als 60 Frauen nutzen die Angebote. Um einen Gegenpol zu schaffen zur israelischen Propaganda, die Touristen nach Alwin einlädt, um den geplanten Bibelpark vorzustellen, gibt es einen kleinen Vorführraum, in dem interessierten Kleingruppen ein Video gezeigt wird.
Als ich es mir ansah, war ich sehr erschüttert über das teilweise brutale Vorgehen der Sicherheitsbehörden. Ich sah, wie ein flüchtendes Kind von einem Polizeiwagen verfolgt und so gerammt wurde, dass es auf die Kühlerhaube geschleudert wurde und danach auf die Straße flog. Die Wagen stoppte, die Polizisten schnappten den auf dem Boden liegenden Jungen, zerrten ihn ins Fahrzeug und fuhren davon.
In der Nähe des Zentrums und innerhalb des Wohngebietes wurde vor einiger Zeit von freiwiligen Helfern auf einem freien Gelände eine Spiel- und Sportstätte eingerichtet. Finanziell gefördert wurde dieses Projekt mit Geldern des Entwicklungshilfeministeriums in Bonn. Eines Tages rückte ein Bulldozer an und machte alles platt. Begründung: Innerhalb des für den Bibelpark vorgesehenen Geländes sei dies illegal. Zwei Straßen weiter haben jüdische Siedler ein Gelände eingezäunt, ein großes Zelt aufgestellt und davor einen Grillplatz gebaut. Sie benutzen dies für Freizeitaktivitäten. Es steht bis heute.
(Ich hatte in Hebron berichtet, dass jüdische Siedlerjugendliche Steine in den palästinensischen Andenkenladen werfen. Ihnen geschieht nichts.)
Viele Grüße
Joachim (Mauer)
E-Mail vom 24.11.2012
Liebe Freunde,
den Tag vor unserer Heimreise fuhren wir nach TelAviv, um uns die Stadt anzuschauen Außerdem wollte ich die Gelegenheit ergreifen, ein letztes Mal für dieses Jahr im Meer zu baden.
Von unserer Unterkunft auf dem Ölberg nahm uns wieder ein Privatauto zum Bustarif mit zum Damaskustor. Dort ging es mit der Straßenbahn weiter zur Central Station in West-Jerusalem. Die Central Station ist der zentrale Busbahnhof von Jerusalem. Von hier aus kommt man mit den „grünen“ Bussen in alle Teile des Landes.
In Israel fährt jeder mit dem Bus. Man hat ausgerechnet, dass auf täglich 44.957 Fahrten 810.500 Kilometer zurückgelegt und mehr als eine Million Menschen transportiert werden. Das entspricht einem Sechstel der Gesamtbevölkerung des Landes.
Obwohl Sonntag war, war bereits am Eingang eine Menge los. Auch an der Central Station muss man Sprengstoffschnüffelmaschinen und Piepsrahmen passieren. Kontrolleure stehen zum Körperabtasten bereit. Es bildete sich eine Schlange, die jedoch zügig „abgearbeitet“ wurde. Die Israelis haben sich an die Kontrollen gewöhnt.
Viele jungen Soldatinnen und Soldaten strömen ins Gebäude. Das Wochenende ist vorbei, und sie müssen in ihre Kasernen zurück.
Ich habe so meine Probleme mit den Wochenenden. Für die muslimischen Israelis ist Freitag der wichtigste Wochenendtag, für die jüdischen der Samstag (Sabbat) und für die Christen der Sonntag. Dementsprechend sind auch die Geschäfte geschlossen bzw. geöffnet. Ich nehme an, dass für die Soldaten Freitag und Samstag Wochenende ist.
Der Busbahnhof ist ein riesiges Gebäude. Man kommt an vielen Geschäften vorbei, fährt Rolltreppen und muss durch den ganzen Komplex hindurch und hinten gibt es die Bahnsteige, wo die Busse abfahren.
Unser Bus nach TelAviv stand 10 Minuten vor der Abfahrtszeit am Bahnsteig bereit. Ich hatte den Eindruck, dass die Soldaten zuerst einsteigen dürfen; denn sie gingen nach vorne, ohne dass jemand meckerte. Das Gepäck kommt ins Untergeschoss des Busses. Die Klappen können vom Fahrer per Knopfdruck im Bus geöffnet werden, und jeder hat sich selbst um das Gepäckeinladen zu kümmern. Wir nehmen in einer Sitzreihe hinter zwei Soldatinnen Platz. Der Lover der einen (ebenso Soldat) verlässt den Bus. Zuvor hat er sich gerade mit viel Gedöns von seiner Freundin verabschiedet. Diese schnappt ihr Handy und tippt, der Lover draußen hebt ab. Das Geturtel geht weiter. Muss Liebe schön sein! Jean-Pierre und ich beobachten das Spiel der Beiden wohlwollend, vielleicht auch ein wenig neidisch. Übrigens: Die Armee ist Israels größte Heiratsagentur. Der Bus ist mittlerweile gut gefüllt, und es geht pünktlich los. Eine knappe Stunde brauchen wir für die 71 km bis zur Central Station in TelAviv. Wir fragen uns im Busbahnhof durch und erfahren, dass wir zu den städtischen Bussen eine Etage tiefer müssen
Auf der Suche nach einer Toilette hatte ich noch ein nettes Erlebnis. Die Eingänge zum Stillen Örtchen sind mit einem Drehkreuz versperrt, und man muss einen Schekel (20 Cent) in eine kleine Box daneben einwerfen. Zweimal habe ich dies versucht. Das Drehkreuz blieb versperrt, meine Geldstücke waren geschluckt und ich hatte keine mehr. Ein Israeli, der hinter mir stand, warf seinen Schekel ein und hatte Erfolg. Er schob sich ins Drehkreuz, zog den Bauch ein und gab mir ein Zeichen mich dahinterzustellen. Er drückte am Drehkreuz und wir tippelten gemeinsam hindurch. Das Problem war gelöst.
Wir durchquerten mit dem Bus die Innenstadt. Moderne Gebäude und Geschäfte sowie viele
Menschen auf den Straßen. Wir fuhren bis Jaffa, dem Stadtteil, der am Meer liegt. In der Nähe der amerikanischen Botschaft stiegen wir aus. Die Amis haben sich ein Filetstückchen geschnappt. Ihre Vertretung liegt direkt am Meer.
Die Strandpromenade ist gespickt mit Hotelhochhäusern. Im Sommer muss da die Hölle los sein. Als wir ankamen, war es sonnig und über dreißig Grad. Wir suchten uns ein schattiges Plätzchen in einer Strandbar. Die Preise waren gesalzen. Mich hielt nichts mehr, und ich genoss anschließend das Bad im Mittelmeer. Vorgelagertes Felsgestein brach die Wellen. Ideal!
Übrigens: Ich sah genau diese Stelle acht Tage später zu Hause im Fernsehen. Denn hinter diesem Felsgestein war eine Hamasrakete aus Gaza ins Meer gestürzt.
Am frühen Nachmittag spazierten wir die „Allenby“ Prachtstraße entlang. Für uns war der kurze Abstecher nach TelAviv zu Ende, und es ging wieder nach Jerusalem zurück.
Der Inhaber unseres arabischen Restaurants in der Nähe des Damaskustores freute ich, als wir kamen. Es war ein Abschiedsessen. Ein bisschen Wehmut und die Vorfreude auf zu Hause hielten sich die Waage.
In unsere Unterkunft zum letzten Mal: Wäsche waschen, vortrocken, duschen, Leine ziehen, Wäsche aufhängen und danach „Was war gut? Was war weniger gut?“ Es wurde noch ein langer Abend.
Viele Grüße
Joachim (Mauer)
E-Mail vom 25.11.2012
Liebe Freunde,
Der letzte Tag war angebrochen. Die Rücksäcke sind gepackt. Ein letztes Frühstück bei Ibrahim im Gästehaus auf dem Ölberg. Wir verabschieden uns herzlich von ihm. Dieses Mal nehmen wir in der Central Station den Bus nach Haifa. Er macht Zwischenstopp in der Nähe des Ben Gorion Flughafens. Vom Haltepunkt gibt es einen Zubringerbus. Das Flughafengelände ist riesig und mit einem Zaun umgeben. Am Eingangstor die erste Kontrolle: Ein Militär kommt in den Bus, hebt die Papierkorbdeckel hoch, schaut unter die Sitze und uns streng an. Danach lässt er uns passieren. Am ersten großen Gebäude steigen wir aus. Wir denken, wir sind da. Doch der Busfahrer fängt uns wieder ein.
Wir mussten noch ein ganzes Stück fahren, bis wir zum Terminal B, dem internationalen Bereich des Flughafens, kamen. Er ist seit 2004 im Betrieb und hat eine Gesamtfläche von 10.000m². Der Bau war eines der größten Infrastrukturprojekte in der Geschichte Israels. Es können bis zu 16 Millionen Passagiere im Jahr abgefertigt werden. Abgefertigt werden wollten wir möglichst früh und fanden uns bereits um 11 Uhr ein, obwohl die Abflugzeit erst um 17.25 Uhr war. Man erzählte uns vorher von den rigiden und zeitaufwendigen Sicherheitskontrollen, weshalb der Flughafen als der sicherste in der Welt gilt.
Wir folgen den Piktogrammen „Abflug“ und benutzen den Aufzug und kommen in eine riesig große Halle. Dort finden die Befragungen und die Gepäckkontrollen statt. Man muss sich – gemäß seinem Flug – in einem Bereich aufstellen. Die Halle war proppevoll. Einige Tausend Passagiere wurden gerade abgefertigt oder waren in der Warteschleife. Wir wollten uns anstellen. Doch man schickte uns weg mit dem Hinweise, wir sollten um 14 Uhr wieder kommen.
Das taten wir auch und stellten uns an. Vorne sahen wir, wie Sicherheitsbeamte sich jeden einzelnen Passagier vorknöpften und ihm Fragen stellten. „Hoffentlich reden die französisch oder deutsch. Sonst haben wir ein Problem“, dachte ich. Endlich kamen wir dran und der Befrager stellte rasch fest, dass er mit unserem Englisch nichts anfangen konnte. Er: „German?“ Ich: „Yes!“ Da holte er ein Blatt und da standen seine Fragen in Deutsch drauf. In Französisch hatte er so was nicht. So übersetzte ich und wir konnten mit yes oder no antworten. Ich habe mir die Fragen nicht alle gemerkt. Einmal frug man, ob mir jemand im Flughafen oder vorher ein Brief oder Päckchen in die Hand gedrückt habe.
Die Befragungshürde war also genommen und unser Gepäck wanderte in die Maschine. Sie war ein big brother unserer Sprengstoffschnüffelmaschinen, die wir zu genüge kannten, nur viel, viel mächtiger. In meiner Fantasie erschien sie mir wie ein Drache. Ins Maul wanderte das Gepäck und nach einiger Zeit hinten wieder raus. Wenn er Sprengstoff schmeckte, spie er Feuer.
Damit war die Reisegepäckkontrolle noch nicht erledigt. Mit breiten langen Tischen hat man ein großes U geformt. In dem U stehen weitere Gepäckkontrolleure und vor dem U die Passagiere. Die Koffer müssen auf die Tische gestellt werden. Ich nehme an, die werden durchleuchtet; denn an der Seite steht jeweils ein zum Kontrolleur gerichteter großer Bildschirm, auf dem man ein Röntgenbild sieht.
Beim Warten beobachtete ich das Ganze. Viele müssen die Koffer aufmachen, und es wird fleißig darin herumgewühlt. Beauty Cases mussten ausgekippt werden. „Oh Gott“, denke ich. „Was werden sie wohl mit uns Rucksack-Freaks anstellen?“ Wir legen also unsere Ruckis auf den Röntgentisch. Unser freundlicher Kontrolleur schaut auf den Bildschirm. Wir verstehen sogar seine Frage, ob da nur Wandersachen drin seien. Er gibt sich damit zufrieden. Kein Öffnen, kein Wühlen, kein Auskippen. Der Sack blieb ungeöffnet. Super!
So konnten wir den ganzen Trubel verlassen, um unseren Check-In-Schalter zu suchen. Wir hatten bei Germanwings gebucht, kurzfristig und doch recht günstig. Die Abfertigung ging rasch, da wir sehr früh waren, und deshalb die Schlange noch kurz war.
Nun mussten wir noch zur Handgepäck- und Körperkontrolle. Wieder hatten sich lange Reihen gebildet. Bei mir piepste nichts und bei Jean-Pierre auch nicht. So war das auch erledigt.
Als letztes dann noch die Passkontrolle. Auch wieder anstehen. Sehr gründlich betrachtete die Polizistin mein Dokument. „Ist was?“ denke ich. „Habe ich zu viele Palästinenser angelächelt? Haben mich die Kameras in Silwan als verdächtig gemeldet?“ Ich atme auf, als ich den Pass zurückbekomme. Endlich durch! Endlich im Transit!
Nun zeigte sich der Flughafen von seiner besten Seite. Der Transitbereich ist super: Ein großer Brunnen mit Wasserspielen in der Mitte und rundum Restaurants, Imbissstände und jede Menge Geschäfte. Ich will nur noch chillen; immerhin hatten wir gerade sechs Kontrollen hinter uns. Obwohl die Kontrolleure stets höflich waren, die Nervenanspannung war noch da.
Unseren Nachbarn, einem deutschen Ehepaar, ging es wahrscheinlich ebenso. Sie stritten sich, ob sie jetzt was essen sollten oder im Flugzeug. Er stampfte in Richtung Kiosk, sie rollte die Augen. „Das ist der Kontrollstress“, sagte ich zu ihr. Sie nickt.
Am Gate war das dann noch heftiger bei zwei jungen Frauen, Freundinnen. Die eine wollte mal eine rauchen, die andere Wasser holen. Die haben sich richtig gezofft. Die Durstige zischte ab, die Raucherin blieb zurück. Das Handgepäck sollte wohl nicht alleine bleiben. „Ich rede nicht mehr mit dir“, rief sie der Scheidenden wutentbrannt nach. Die wiederum tippte nach ihrer Rückkehr eine SMS ins Handy. Ich schaute ihr über die Schulter. Sie beschwerte sich mit drastischen Ausdrücken über ihre Freundin.
Der Flug ging verspätet ab, da der Sicherheitsoffizier das Flugzeug nicht gleich freigab. Mir kamen schon Zweifel, ob wir unseren Zug in Köln kriegen. Der Flug war gut. Wir sahen nacheinander die Lichter einiger Ägäisinseln, von Athen und Tirana, flogen die kroatische Küste hinauf, über die Alpen und waren nach viereinhalb Stunden mit geringer Verspätung in Köln.
Es war mittlerweile 22.30 Uhr. Die Abfertigung einschließlich Gepäck war in 15 Minuten erledigt. Wir bekamen noch unseren Zug und mit Umsteigen im HBF waren wir kurz vor Mitternacht in Aachen. Es folgte ein letzter halbstündiger Marsch zu meiner Tochter, bei der mein Auto stand.
Es war am nächsten Tag etwas ungewohnt nach zwei Monaten Abstinenz wieder am Steuer zu sitzen. Mittags waren wir in Mehren und nachmittags kam Jean-Pierre’s Lebensgefährtin aus Namur. Abends gingen wir zum Kroaten in Daun gut essen. Nach den Tagen im arabischen Restaurant am Damaskustor eine willkommene Abwechslung. Am folgenden Tag, nach einem guten deutschen Frühstück bei mir zu Hause, fuhr Jean-Pierre nebst Freundin in die belgische Heimat zurück.
Das war’s
Viele Grüße
Joachim (Mauer)
E-Mail vom 29.10.2012
Bonjour Max,
nous sommes bien arrives a Jérusalem le 21 octobre très tard. Les quinze jours passes en Israël nous a permis de voir énormément de choses: Les lieux saints, la Palestine et ses nombreux problèmes. Nous avons visités en autre, Jérusalem, Bethlehem, Nazareth, la mer morte, Massada, Jéricho, Hébron, Ramallah, Naplouse, Jenin, Tel Avis et le lac de Tiberi.
Nous avons l’occasion de rencontrer beaucoup de personnes sur le chemin: Palestiniens, Arabes, Juifs, Israéliens. A Naplouse nous avons logé dans une famille. Expérience très enrichissante.
Nous avons vu le mur et constate les conséquences pénibles pour les Palestiniens. Au check point entre Jenin et Nazareth nous avons vécu personnellement le comportement brutal des militaires israéliens.
Nous avons eu la chance de marcher sur le “Jésus Trail” (sentier de Jésus) de Nazareth. Canaa, Karphanaum. 60 km en trois jours et nous avons loge dans un Kibboutz pour arriver au lac de Tiberias. Le chemin est magnifique parmi les oliviers et les collines de Galille.
Notre pèlerinage se termine. Nous prendrons l’avion, demain, lundi 5 novembre le soir vers Cologne.
Nous avons vecu un magnifique chemin a travers, l’Italie, la Grèce, l’ile de chypre’ Israël et la Palestine.
Amitiés
Joachim et Jean Pierre